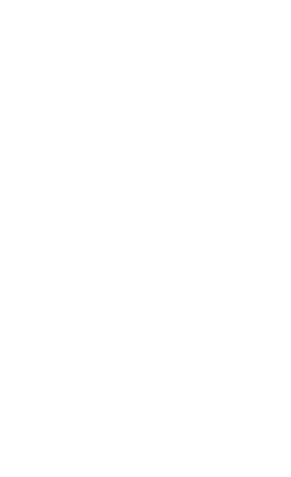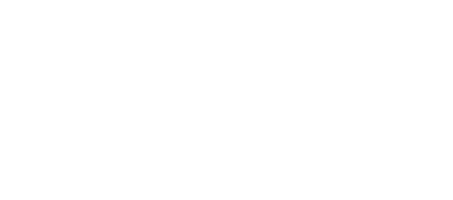Bei ca. 3–6 % der Schwangerschaften stellen sich die Kinder am Geburtstermin in Beckenendlage ein. In diesem Fall wird häufig die Frage gestellt, auf welchem Weg die Geburt für Mutter und Kind möglichst risikoarm ablaufen kann. Grundsätzlich ist eine Spontangeburt (normale Geburt) aus kindlicher Beckenendlage möglich. Dies setzt jedoch eine individuelle Beratung auf Basis der erhobenen Befunde in der Schwangerschaft und eine gute Aufklärung über den Ablauf einer Geburt aus Beckenendlage voraus. Zusätzlich muss ein erfahrenes Team für die Geburt anwesend sein, welches sicher im Umgang mit speziellen Handgriffen ist, die für die Entwicklung des Kindes aus Beckenendlage notwendig werden können.
Bei einer Beckenendlage besteht aber auch die Möglichkeit, mittels sogenannter „Äußerer Wendung“ zu versuchen, das Kind in Schädellage zu drehen. Unter Anwendung spezieller Handgriffe wird vor dem Einsetzen der Wehen oder eines Blasensprungs versucht, dass sich das Kind mit dem Kopf voran für die Geburt einstellt. Eine äußere Wendung wird meist in der 37+0 SSW vorgenommen.
Alternativ besteht die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt zu planen. Grundsätzlich zeigen Studienergebnisse eindeutig, dass ein Kaiserschnitt bei vorliegender Beckenendlage nicht in jedem Fall einen Vorteil für Mutter und Kind darstellt. Sollte Ihr Kind in Beckenendlage liegen, bitten wir Sie, sich in unserem Zentrum vorzustellen, um Ihre individuelle Schwangerschaftssituation zu erfassen und Ihnen Vorschläge zu unterbreiten, sodass Sie eine informierte Entscheidung treffen und die weiteren Schritte geplant werden können.
Die Entscheidung über den Geburtsmodus bei Beckenendlage des Kindes ist stets eine individuelle Entscheidung der werdenden Mutter. Eine sichere und selbstbestimmte Geburt ist uns für Sie besonders wichtig. Wir möchten im Folgenden über die Möglichkeiten bei fetaler Beckenendlage informieren, um eine gemeine Entscheidungsgrundlage für die Geburt Ihres Kindes zu formen.