In enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, Institutionen und Zentren sind wir bestrebt diese Krankheitsbilder näher zu erforschen und damit nicht nur mehr über die Entstehung der Erkrankungen zu verstehen, sondern auch Therapiemöglichkeiten sowie Diagnostiken stetig neu zu evaluieren und zu verbessern.
Forschung Neurofibromatose/Schwannomatosen
Unsere Arbeitsgruppe Neurofibromatose und Schwannomatosen beschäftigt sich mit folgenden Fragestellungen bei allen Altersgruppen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene):
- Wachstumsverhalten und neurologisches Outcome (v.a. Hörvermögen) bei NF2-assoziierten Tumoren im natürlichen Verlauf und unter Therapie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Molekulargenetische Analyse der Tumorgenese und gezielter pharmakologische Therapieansätze bei NF2-assoziierten Tumoren
- KI-basierte Verfahren zur Durchführung einer Tumorvolumetrie (PD Dr. med. Florian Grimm)
- Bestimmung und Monitoring des Durchmessers der Sehnervenscheide (optic nerve sheath diameter, kurz ONSD) bei NF2 Patienten mit intrakraniellen Meningeomen
- Radiochirurgie bei NF2-assoziierten Tumoren
- Klinische Phase Studie (Phase I/II) der Anwendung des MEK I/II-Inhibitors Selumetinib (AZD6244 Hydrogen Sulfat) bei Kindern und Erwachsenen mit Neurofibromatose Typ 1 und inoperablen plexiformen Neurofibromen (SPRINKLE, KOSELUGOTM)
Wissenschaftliche Projekte
„Wachstumsverhalten und neurologisches Outcome (v.a. Hörvermögen) bei NF2-assoziierten Tumoren im natürlichen Verlauf und unter Therapie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.“
Analyse des Wachstumsverhalten von NF2 assoziierten Tumoren per softwarebasierter Volumenkalkulation
Die Magnetresonanztomographie (MRT) spielt nicht nur in der Diagnosestellung der NF2-Erkrankung eine wichtige Rolle, sondern auch in den langfristigen Kontrollen. Insbesondere zur Überwachung der beidseitigen Vestibularisschwannome (VS) sind regelhafte kranielle MRT-Kontrollen unverzichtbar. Standardmäßig in unserem Zentrum werden daraus die Tumorvolumina mit einer Software (Abbildung 2) kalkuliert. Diese Prozedere ist sehr aufwändig und zeitkonsumierend, aber sehr sensitiv und unverzichtbar um auf Basis dessen auch Therapieindikationen zu stellen und diese zu überwachen (z. B. Operation).
Wir konnten innerhalb unserer Arbeitsgruppe ausführliche Analysen der Vestibularisschwannome bereits abschließen und publizieren (Gugel et al. J Neurosurg Pediatr. 2019; Gugel et al. Cancers (Basel) 2019. Hierfür steht eine große Datenbank mit über 5000 Datensätzen zur Verfügung. Zudem werden diese auf weitere NF2 assoziierte Tumore ausgeweitet.
KI-basierte Verfahren zur Durchführung einer Tumorvolumetrie
Eine Tumorvolumetrie zur Beurteilung der Vestibularisschwannome ist wichtig zur Einschätzung der Wachstumsdynamik. Diese ist jedoch sehr zeitintensiv. Im Rahmen von wissenschaflichen Projekten mit Industriepartnern sollen anhand von Trainingsdatensätze Deep-Learning Verfahren zur automatisierten Volumetrie beübt und entwickelt werden.
Analyse des Hörvermögens im Langzeitverlauf unter Betrachtung von Einflussfaktoren (insbesondere Operation, medikamentöse Therapie, Bestrahlung) bei NF2-assoziierten Vestibularisschwannomen
Aufgrund der beidseitigen Manifestation der Vestibularisschwannome bei NF2 Patienten besteht ein hohes Risiko des beidseitigen Hörverlustes über die Lebenszeit. Dieser kann schwerwiegende soziale Folgen mit sich bringen. Aufgrund dessen ist der frühzeitige und langfristige Hörerhalt ein wichtiges Ziel im Management der Erkrankung. Unverzichtbar ist die frühzeitige Diagnosestellung, das frühzeitige und regelhafte Hörscreening mittels Ton- und Sprachaudiometrie sowie die Durchführung von akustisch evozierten Potenzialen und natürlich die MRT-Diagnostik zur Kontrolle des Tumorwachstums. Die operative Therapie spielt eine sehr wichtige und große Rolle, da diese Tumore zum aktuellen Zeitpunkt nicht heilbar sind. Ein restriktiveres chirurgisches Vorgehen im Sinne einer operativen Dekompression des inneren Gehörgangs mit oder ohne angeschlossener und elektrophysiologisch gestützter Teilresektion zeigt sehr gute Ergebnisse nicht nur im Hörerhalt (Gugel et al. Cancers (Basel) 2019), sondern auch in der Reduktion der Wachstumsgeschwindigkeit (Gugel et al. J Neurosurg Pediatr. 2019). Bei zeitgleich geringem perioperativem Risiko spielt diese Therapieform eine äußerst wichtige Rolle vor allem bei jungen NF2 Patienten.
Trotz dessen, dass es keine NF2-spezifische und zugelassene medikamentöse Therapie gibt, ist die Anwendung des Antikörpers Bevacizumab in der Literatur bei NF2-assoziierten Vestibularisschwannomen sehr gut untersucht und beschrieben. Bei häufig alternativloser Situation, ohne Aussichten auf Heilung stellt diese nicht selten die einzig verbleibende Möglichkeit zur Verzögerung des Hörverlustes und Reduktion der Wachstumsdynamik dar. Aufgrund der notwendigen Langzeitapplikation und dem ungewissen Langzeitnebenwirkungsprofils sollte eine onkologische Anwendung jedoch erst im späten Jugendalter oder Erwachsenenalter in Erwägung gezogen werden. Neue therapeutische Optionen (z. B. Brigatinib) wurden in internationalen Studien untersucht, Ihre
Die Bestrahlung findet nur selten in ausgewählten Fällen Ihre Anwendung aufgrund des hohen Risikos des strahleninduzierten Hörverlustes und (trotz Seltenheit) der in Einzelfällen möglichen malignen Entartung aufgrund der genetischen Komponente.
Molekulargenetische Analyse der Tumorgenese von NF2-assoziierten Tumoren
Die NF2 wird durch eine Inaktivierung des NF2 Gens auf dem Chromosom 22q hervorgerufen. Dadurch kann dessen Proteinprodukt Merlin (Moesin-Ezrin-Radixin-like Protein) seine Funktion als Tumorsuppressorgen nicht mehr wahrnehmen und Abläufe wie das Zellwachstum, der Zelltod etc. werden dadurch gestört. Das routinemäßige Screening auf das Vorliegen einer NF2 Mutation im Blut findet in der klinischen Routine seine Anwendung. Bei ca. 30% der Fälle kann diese jedoch nicht im Blut, dafür aber in der Tumor-DNA in 2 unabhängigen Tumoren nachgewiesen werden (sogenannte Mosaike). Auch das gänzliche nicht Vorhandensein einer NF2 Mutation bei klinisch erfüllten Kriterien schließt die Erkrankung nicht aus und führt zu der Annahme, dass weitere genetische Mechanismen vorliegen müssen, die die Entstehung der Erkrankung mitbedingen. Die Interaktionen rund um das NF2 Gen sind bisher gut erforscht aber komplex, was weiterhin eine Heilung nicht ermöglicht. Zudem nehmen Therapieformen (z. B. Operation, Off-Label Bevacizumab, Bestrahlung) möglicherweise Einfluss auf das Verhalten der Tumore. Auch dieser Aspekt muss berücksichtigt und weiter erforscht werden um beispielsweise gezielte Therapieformen für ein wiederholtes oder resistentes Wachstum zu entwickeln.
Unsere Arbeitsgruppe konnte beispielweise bei strahlenresistenten NF2 assoziierten Vestibularisschwannomen eine Dysregulation der Transkripte PTEN und mTOR nachweisen (Gugel et al. Cancers (Basel) 2020, “Contribution of mTOR and PTEN to Radioresistance in Sporadic and NF2-Associated Vestibular Schwannomas: A Microarray and Pathway Analysis.”), die theoretisch pharmakologisch angehbar sind. Weitere Studien sind bereits in Bearbeitung.
Target NF2
Eine gezielte systemische Therapie zur Behandlung der oft multipelst vorliegenden Tumortypen wäre wünschenswert. Hierbei ist eine molekulargenetische Betrachtungsweise der einzelnen Patienten und Tumore unverzichtbar. Wir verfügen über eine große NF2 Biodatenbank und klinische Datenbank (Volumetrie, neurologische Parameter), die uns eine umfassende Betrachtungsweise gewährleisten.
Im Rahmen von Kooperationsprojekten können wir zudem auf eine weiterführende Expertise zur Ergänzung unserer Primäranalysen (z. B. 3D in vitro Modelle, CAR T Zellmodell) zurückgreifen.
Auswirkung der Strahlentherapie bei NF2-assoziierten, intrakraniellen Tumoren
Die Bestrahlung findet aufgrund des seltenen, aber beschriebenen Risikos einer Entartung nur in gut evaluierten Fällen Ihre Anwendung bei NF2 Patienten. Auch funktionelle Verluste (z. B. Hörvermögen) sind anschließend möglich. Dennoch sind durch die eingeschränkten Therapieoptionen und dem damit behafteten Risiko einer neurologischen Verschlechterung diese in Fällen notwendig. Zusammen mit strahlentherapeutischen Zentren untersuchen wir den Effekt der Bestrahlung hinsichtlich Wachstumskontrolle und neurologischer Funktion bei NF2 Patienten mit bestrahlten intrakraniellen Tumoren.
Bestimmung und Monitoring des Durchmessers der Sehnervenscheide (optic nerve sheath diameter, kurz ONSD) bei NF2 Patienten mit intrakraniellen Meningeomen
Die Bestimmung des Durchmessers der Sehnervenscheide über Ultraschall oder eine hochauflösende MRT spiegelt den intrakraniellen Druck sehr gut wieder. Vor allem bei NF2 Patienten mit mehreren intrakraniellen Meningeome oder jene, die an den großen Hirnvenen angrenzen können langfrisitg zu einem erhöhten intrakraniellen Druck und damit assoziierten Beschwerden (Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen) führen. Die Therapie ist komplex, neben operativen Maßnahmen (Entfernung der Meningeome, Maßnahmen zur Verbesserung des Hirnwasserabflusses wie der VP-Shunt) stehen keine systemischen Therapieabsätze zur Behebung der Problematik aktuell zur Verfügung. Eine frühzeitige Implementierung der ONSD Messung bei diesen Risikopatienten ist notwendig um den Verlauf und die Dynamik einzuordnen und frühzeitig therapeutische Maßnahmen einzuleiten.
Systemische Therapiestudien bei NF1 Patienten
- Klinische Phase Studie (Phase I/II) SPRINKLE und KOSELUGOTM mit der Firma Astrazeneca bei Kindern und Erwachsenen mit NF1-
Die Entstehung von plexiformen Neurofibromen (PNF) bei NF1 Patienten findet meist sehr früh im Kindes- und Jugendalter statt, aber auch Erwachsene sind regelhaft davon betroffen. In der Regel können diese Tumore zunächst beobachtet werden, es sei denn, sie liegen an einer funktionell relevanten Stelle, lösen Beschwerden aus oder sind sehr stoffwechselaktiv und haben somit den Verdacht auf eine beginnende oder bereits bestehende maligne Entartung. Bisher ist die Operation die Therapie der Wahl für solche Tumore. Nicht alle Tumore sind jedoch dafür zugänglich oder so ausgedehnt, dass operative Verfahren äußerst mutilierend sein können bzw. nicht den Tumor vollständig entfernen können. Für diese Fälle stellen MEK I/II-Inhibitoren (MAP Kinase = MEK) eine Alternative dar. Hierbei wurden in den USA bereits gute und erfolgsversprechende Studien durchgeführt und veröffentlicht (Gross und Widemann et al. N Engl J Med. 2020). Speziell der MEKI/II-Inhibitor Selumetinib (AZD6244 Hydrogen Sulfat) war bisher in Deutschland noch nicht zugelassen und soll nun in einer deutschlandweiten klinischen Phase Studie (Phase I/II) bei Kindern und Erwachsenen mit Neurofibromatose Typ 1 und inoperablen plexiformen Neurofibromen untersucht werden. Hierbei wurde in unserem Zentrum für Neurofibromatose die Erwachsenenstudie (KOSELUGOTM) mit Abschluss der Rekrutierungsphase durchgeführt. Die Kinderstudie (SPRINKLE) ist weiterhin laufend mit voraussichtlicher Rekrutierungsphase bis 2026.
Ansprechpartner (PIs) hierfür sind:
Prof. Dr. med. Martin U. Schuhmann (SPRINKLE, KOSELUGO)
Sektion Pädiatrische Neurochirurgie
Department für Neurochirurgie und Neurotechnologie und Zentrum für Neurofibromatose und Schwannomatosen, Universitätsklinikum Tübingen
PD Dr. med. Isabel Gugel (KOSELUGO)
Department für Neurochirurgie und Neurotechnologie und Zentrum für Neurofibromatose und Schwannomatosen, Universitätsklinikum Tübingen
PD Dr. med. Ines Brecht (SPRINKLE)
Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, Universitätsklinikum Tübingen
Danke für Ihre Unterstützung
Elementar für unser Forschungsvorhaben ist die gute Kooperation und Unterstützung mit und durch unsere Patienten, wofür wir uns herzlich bedanken.
Wenn Sie unser Forschungsvorhaben (oder gezielte Projekte) ferner gerne unterstützen möchten würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung sehr freuen!
Förderkonto Neurochirurgie Forschung & Lehre BW Bank Stuttgart IBAN: DE41 6005 0101 7477 5037 93 BIC: SOLADEST600 Verwendungszweck: Neurofibromatose D.30.30644 |
Certificates and Associations
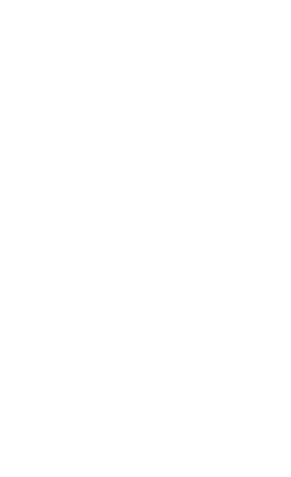
Focus: Top National Hospital 2025

Stern: Germany's Outstanding Employers in Nursing 24/25

Quality partnership with the PKV
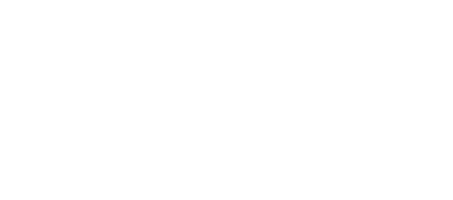
Family as a success factor

Pension provision for the public sector






