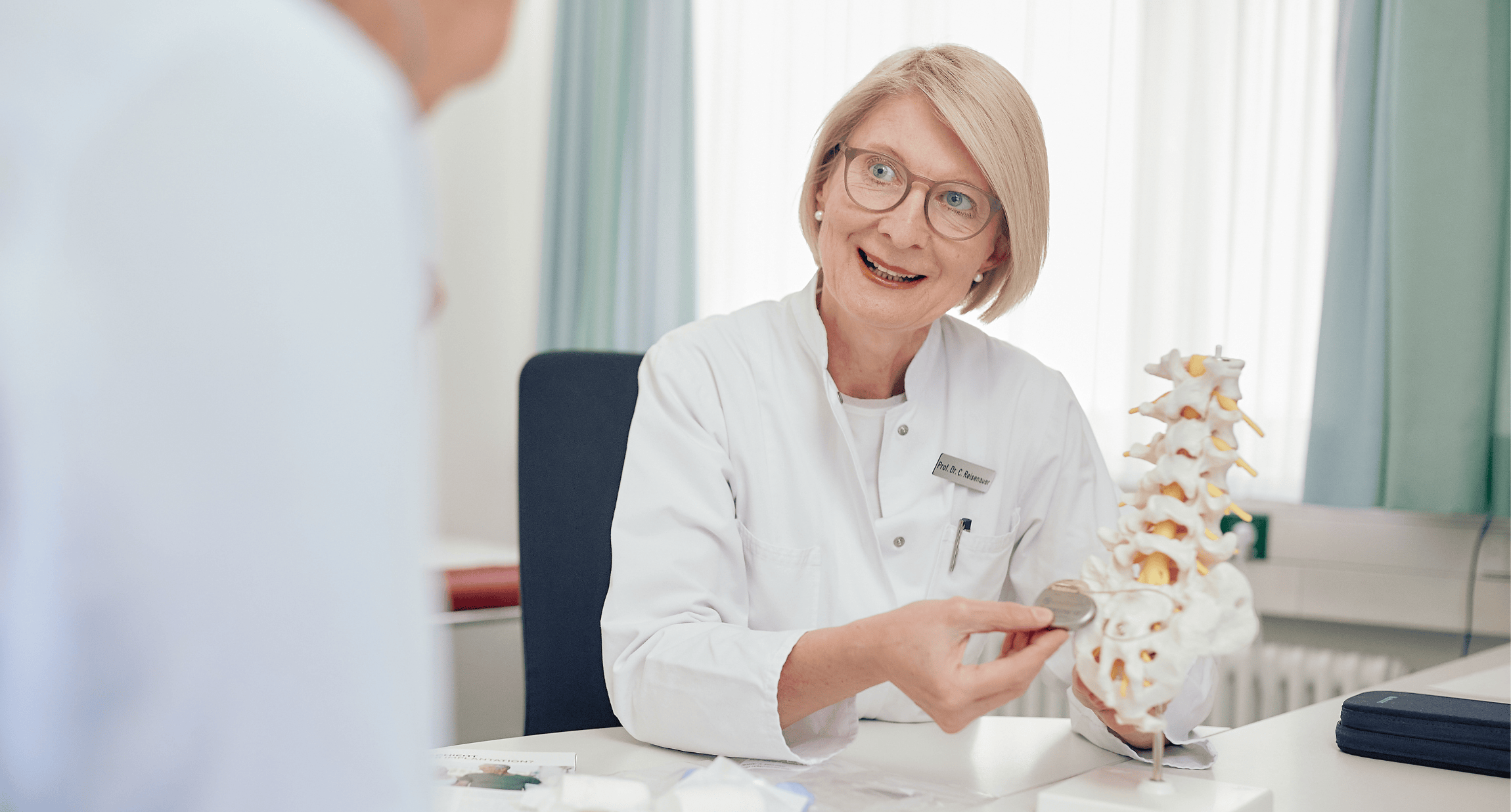Prof. Christl Reisenauer erlebt täglich, wie sehr Blasenschwäche die Lebensqualität einschränkt. Sie ist Leiterin der Sektion Urogynäkologie an der Uni-Frauenklinik Tübingen. Eine 24-Jährige, die nach der Geburt ihres ersten Kindes inkontinent geworden war, berichtete ihr einmal, dass sie sich ohne Einlagen im XXL-Format nicht mehr aus dem Haus traute. Ihr großer Wunsch: „Ich will den Walzer an meiner Hochzeit ohne Einlagen tanzen“, erinnert sich Reisenauer. Nach der Untersuchung in der urogynäkologischen Ambulanz der Frauenklinik entschied sich die junge Mutter für eine Operation. „Sie hat an ihrer Hochzeit wirklich ohne Einlagen getanzt“, erzählt die Gynäkologin.
Wie entsteht Blasenschwäche?
Die häufigste Form der Blasenschwäche ist Belastungsinkontinenz: Frauen verlieren Urin, wenn sich der Druck im Bauchraum erhöht, etwa beim Sport, Lachen oder Niesen. Ursachen sind ein strapazierter Beckenboden nach Schwangerschaft und Geburt oder nach schwerer körperlicher Arbeit sowie eine Bindegewebsschwäche oder hormonelle Veränderungen rund um die Wechseljahre. Belastungsinkontinenz kann in jedem Alter auftreten, trifft aber meist bei Frauen auf, die älter als 50 sind. Seltener ist die Dranginkontinenz. Patientinnen spüren plötzlich einen starken und häufigen Harndrang und schaffen es oft nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette. Betroffen sind meist ältere Frauen, oft findet sich keine körperliche Ursache. Manchmal gibt es auch Mischformen.
Welche Therapien gibt es?
„Lange Zeit haben Frauen das einfach hingenommen“, sagt Reisenauer. Die Gynäkologin, die auch zweite Vorsitzende der Deutschen Kontinenz Gesellschaft ist, arbeitet daran, das zu ändern. Das Tübinger Kontinenz- und Beckenbodenzentrum ist eines von nur 40 solcher Einrichtungen im ganzen Bundesgebiet. Es hat einen exzellenten Ruf und Patientinnen aus ganz Deutschland. Gynäkologen, Chirurgen und Urologen arbeiten hier eng zusammen. Nach der Diagnostik in der urogynäkologischen Sprechstunde stellen Medizinerinnen die Weichen für die Therapie. Oft helfen schon konservative Behandlungen: Spezielle Tampons und Pessare fixieren bei Belastungsinkontinenz die Harnröhre. Bei einer schwachen Beckenbodenmuskulatur wirkt gezielte Krankengymnastik. Bei Übergewicht hilft auch Abnehmen: „Fünf Prozent weniger Gewicht lösen 50 Prozent des Problems“, so Reisenauer.
Oft aber ist eine Operation nötig: Bei der sogenannten TVT-Operation (Tensionfree Vaginal Tape, auf Deutsch: spannungsfreies Scheidenbändchen) wird die Harnröhre mit einem Kunststoffbändchen stabilisiert, sodass sie beispielsweise beim Husten gegen das Bändchen gedrückt wird und dichthält. Der Eingriff erfolgt in lokaler Betäubung von der Scheide aus. Nach einem Tag in der Klinik kann die Patientin nach Hause, nach drei Wochen Schonung ist in 80 bis 90 Prozent der Fälle alles gut. „Wichtig ist, dass das jemand macht, der viel Erfahrung hat“, sagt Reisenauer. Die Tübinger Frauenklinik führt jedes Jahr 170 dieser Eingriffe durch.
Was hilft bei Dranginkontinenz?
Auch bei der Dranginkontinenz gibt es mehrere Behandlungsalternativen. Dranginkontinenz ist eine spezifische Form der Blasenschwäche, bei der es zu plötzlichem, starkem Harndrang mit unwillkürlichem Urinverlust kommt. Neben Beckenbodengymnastik und speziellen Medikamenten erzielen Botoxspritzen oft gute Ergebnisse. In schwierigen Fällen kann ein Blasenschrittmacher, der im Gesäßbereich liegt, eingesetzt werden. Rund 100 Schrittmacherpatientinnen werden in der Sprechstunde betreut.
Wie werden Fisteln im Genitalbereich behandelt?
Beckenbodenspezialistin Reisenauer hat sich auch darauf spezialisiert, Frauen zu operieren, die aufgrund einer Fistel im Genitalbereich inkontinent wurden. Ein bis zwei Patientinnen pro Monat behandelt sie. Fisteln können in sehr selten Fällen – insbesondere nach Gebärmutterentfernungen oder einer Krebsoperation – auftreten. Die Frauen verlieren dann unkontrolliert Harn durch die Scheide. „Ich habe bereits 300 Fistelpatientinnen mit Fisteln zwischen Blase und Scheide beziehungsweise Darm und Scheide behandelt“, sagt die Gynäkologie-Professorin. Die Erfolgsquote für die Behandlung der Blasen-Scheiden-Fisteln liege bei 95 Prozent, die der Darm-Scheiden-Fisteln allerdings niedriger. „Durch das interdisziplinäre Mitwirken der Kolleginnen und Kollegen der Urologie und Chirurgie des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums kann auch Frauen mit sehr komplexen Fisteln geholfen werden“, so Reisenauer. Um sich für diese Operationen zu qualifizieren, absolvierte sie eine Fortbildung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Das dortige Fistula Hospital gilt als weltweit führend.