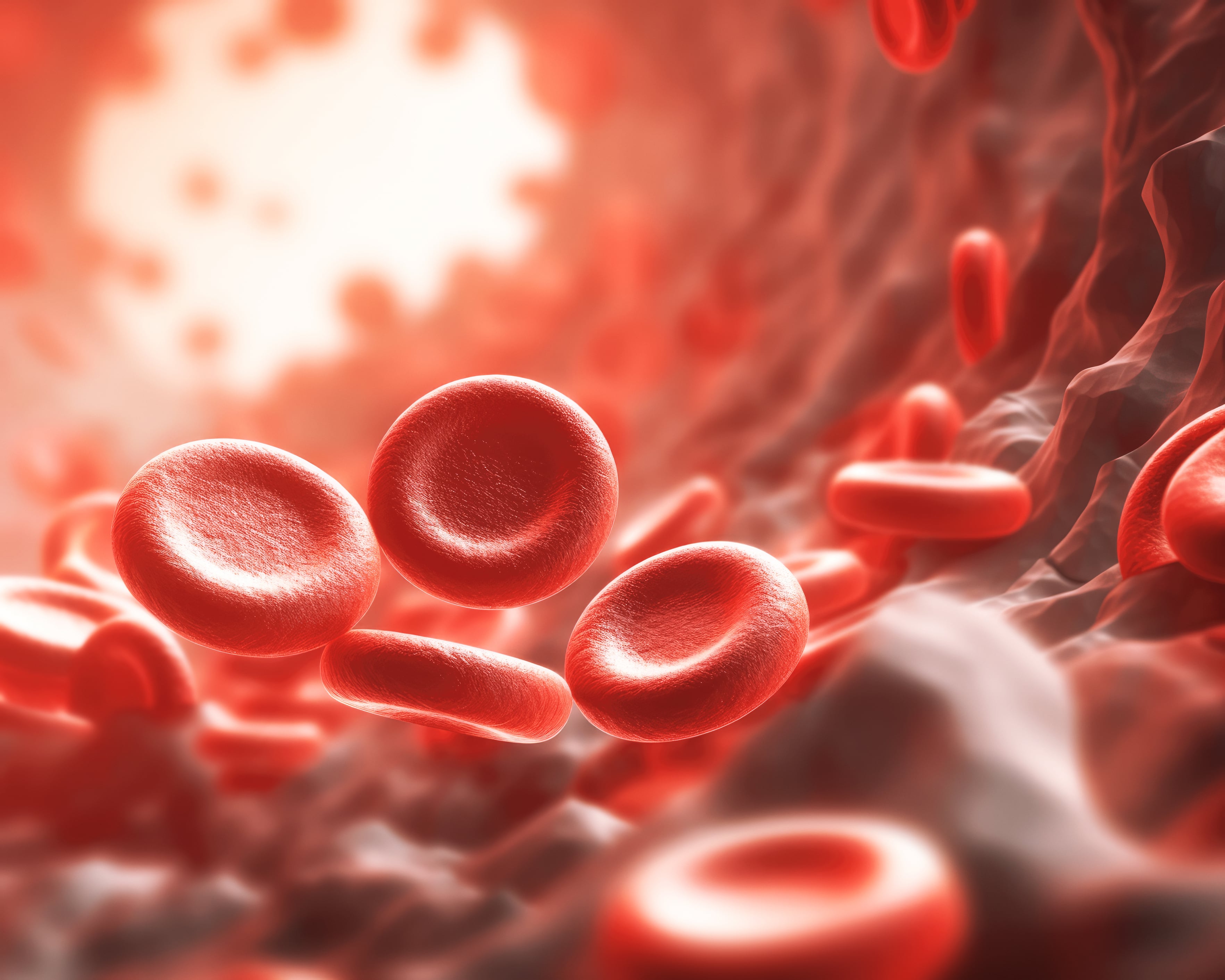Ein Leben ohne Bluttransfusionen
Thalassämie kann jetzt mit Gentherapie behandelt werden
Drei Jahrzehnte war Eleni an Thalassämie erkrankt. Ihr Körper bildete zu wenig Hämoglobin, sie war von Bluttransfusionen abhängig und fühlte sich erschöpft. Eine neue Gentherapie hat nicht nur ihr Leben, sondern auch die Zukunft der Thalassämie-Behandlung verändert.
Nach Mexiko reisen – das hätte Eleni nie für möglich gehalten. Die ersten 30 Jahre ihres Lebens litt sie an der seltenen Bluterkrankung Thalassämie. Große Reisen waren undenkbar. Als sie wenige Monate alt war, wurde festgestellt, dass ihr Körper zu wenig von dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin bildet. Alle vier Wochen musste sie in die Tübinger Uni-Kinderklinik kommen, damit Hämoglobin per Infusion zugeführt werden konnte. „Ich war erschöpft und nicht belastbar. Nach der Bluttransfusion fühlte ich mich zwar besser, aber schon nach einer Woche kam die Erschöpfung zurück“, erinnert sie sich. Ein weiteres Problem: Mit jeder Transfusion gelangt Eisen in den Körper, das von selbst nicht ausgeschieden werden kann. Eine Eisenüberladung in verschiedenen Organen entsteht, die die Lebenserwartung erheblich einschränkt.
Seit 2021 gehören bei Eleni die Bluttransfusionen der Vergangenheit an. Sie durfte als eine von 52 Kindern und jungen Erwachsenen an einer der weltweit ersten internationalen Studien teilnehmen, in der Thalassämie-Erkrankte mit einer Gentherapie behandelt wurden. Seit mehreren Jahren ist das Labor für Gentherapie des Uniklinikums unter Leitung von Dr. Markus Mezger an der Erforschung der Therapie beteiligt. Im Juli 2024 wurde die Therapie in der Europäischen Union zugelassen. „Die Gentherapie für Thalassämie ist ein fantastisches Beispiel dafür, dass Gentherapien wirksam sind und im klinischen Alltag angewendet werden können“, betont Prof. Dr. Peter Lang, der Eleni behandelt und die Stammzelltransplantationen in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin leitet.
Genveränderung mit CRISPR/Cas9
Für die Therapie verbrachte Eleni zwei Monate in der Kinderklinik. Der erste Schritt: Stammzellen aus dem Blut entnehmen. Das auf schwere Krankheiten spezialisierte Biotechnologieunternehmen Vertex behandelt die blutbildenden Stammzellen der Betroffenen mit der Genschere CRISPR/Cas9 so, dass diese wieder das funktionsfähige Hämoglobin des frühen Kindesalters bilden, das keine Schäden trägt. Danach folgt eine Chemotherapie, die das eigene Knochenmark auslöscht. Im Anschluss werden die genmodifizierten Stammzellen transplantiert, aus denen neues Blut gebildet werden kann. Die Therapie von Eleni liegt mittlerweile drei Jahre zurück, die Blutbildung funktioniert einwandfrei, Transfusionen sind nicht mehr nötig. „Die gentechnische Veränderung scheint sehr stabil zu sein, über 90 Prozent der behandelten Patientinnen und Patienten sind nach der Gentherapie länger als ein Jahr ohne Transfusion geblieben“, berichtet Lang.
Die neue Gentherapie ist eine Ergänzung zur Stammzelltransplantation, mit der bisher Thalassämie-Patientinnen und -Patienten behandelt werden konnten. Ersetzen wird sie diese vorerst nicht. Denn die Gentherapie kostet mehrere Millionen Euro. Ob die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden können, wird derzeit geklärt. „Vorerst ist die Gentherapie eine Chance für Erkrankte, für die kein Spender oder keine Spenderin gefunden werden kann oder die aus anderen Gründen keine fremden Stammzellen bekommen können“, erklärt der Thalassämie-Spezialist Lang. Auch wenn die Auswirkungen der Thalassämie schon zu weit fortgeschritten sind, ist die Genveränderung ein neuer Behandlungsansatz.

Mehr Thalassämie-Betroffene in Mitteleuropa
Blutarmut: Die Hämoglobinopathien, zu denen die Thalassämie-Varianten und auch die Sichelzellkrankheit zählen, sind mit sieben Prozent der Weltbevölkerung als Anlageträger die weltweit häufigsten monogenen Erbkrankheiten. Bei Thalassämie haben die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) aufgrund eines Hämoglobindefekts eine geringere Funktionsfähigkeit und eine kürzere Lebensdauer, zudem werden sie in geringerer Zahl gebildet als bei gesunden Menschen. Die Folge ist eine Blutarmut, sodass der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann. Unbehandelt kommt es bei Patientinnen und Patienten zu einer massiven Leber- und Milzvergrößerung, zur Veränderung der Knochenmarksräume und zu Fehlbildungen am Skelettsystem. Ohne eine adäquate Therapie sterben die erkrankten Kinder bis zum fünften Lebensjahr.
Mittelmeerländer: Thalassämie kommt vor allem in den Mittelmeerländern, in den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, auf dem indischen Subkontinent, in Südostasien und in Afrika vor. In Mitteleuropa ist die Zahl von Patienten und Anlageträgerinnen in den letzten Jahrzehnten durch Migration erheblich gestiegen. Schätzungen zufolge leben in Deutschland derzeit etwa 600 Personen mit der schweren Form der ß-Thalassämie (Thalassämia major) und etwa 160.000 Menschen mit Thalassämia minor.