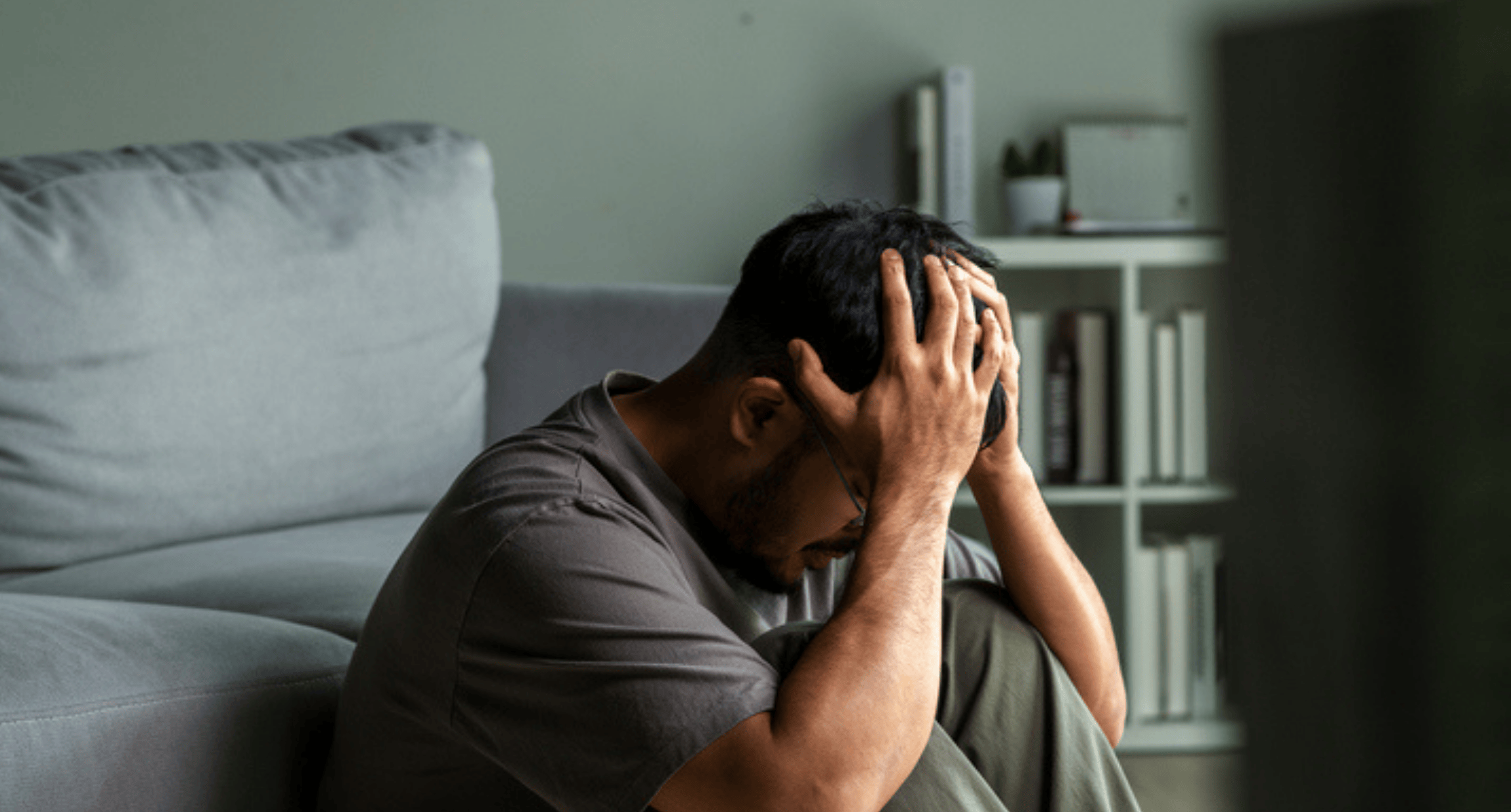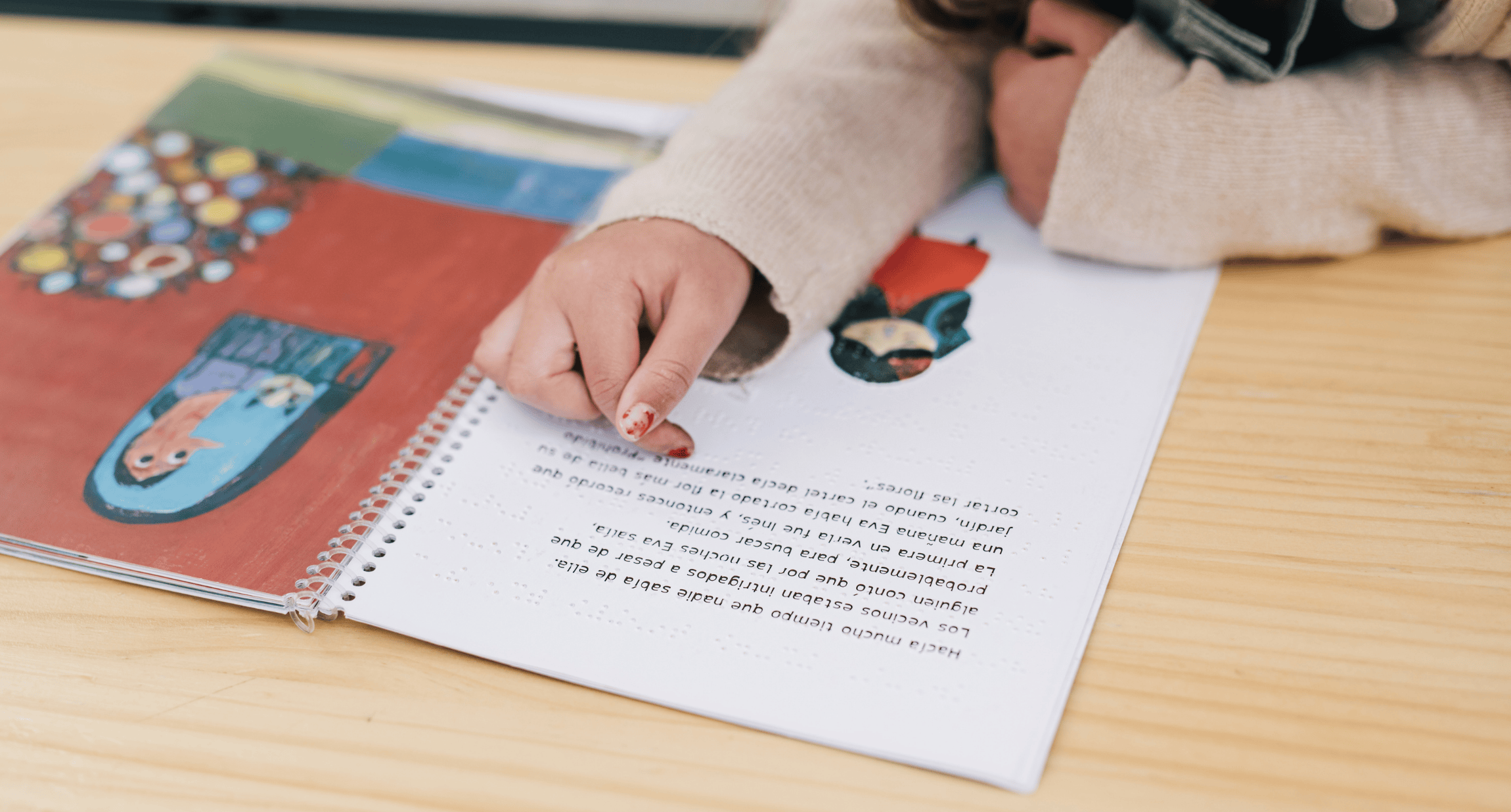Von Geburt an verbringt der Mensch mit nichts anderem so viel Zeit wie mit dem Schlafen. Was dabei passiert, ist mehr als bloße Entspannung: Wenn wir träumen, verarbeitet unser Gehirn verschiedene Erlebnisse und Erfahrungen. Bis zu 20 Mal pro Nacht wachen Menschen auf, schlafen danach aber sofort wieder ein und können sich in der Regel morgens auch nicht daran erinnern.
Guter Schlaf ist für die Regeneration und die Gesundheit sehr wichtig. „Schlaf macht gesund, schlau und schlank“, fasst Privatdozentin Dr. Susanne Diekelmann vom Institut für Medizinische Psychologie des Tübinger Universitätsklinikums zusammen. Studien hätten gezeigt, dass beispielsweise das Risiko einer Erkältung bei Schlafmangel deutlich ansteige. Weil die Festigung neuer Inhalte im Langzeitgedächtnis vor allem im Schlaf stattfindet, ist er auch für die geistige Leistungsfähigkeit von großer Bedeutung. Und nicht zuletzt werden die Hormone, die unser Appetit- und Sättigungsgefühl steuern, von der Schlafdosis beeinflusst.
Eine Zimmertemperatur von höchstens 18 Grad Celsius und möglichst regelmäßige Zeiten für das Schlafengehen und Aufstehen wirken sich positiv auf einen erholsamen Schlaf aus, weiß Professor Dr. Peter Ruth vom Lehrstuhl Pharmakologie und Klinische Pharmazie des Tübinger Instituts für Pharmazie. Vermeiden sollte man hingegen Koffein, Nikotin und große körperliche Anstrengung vor dem Schlafen. Und: „Eine übervolle Blase ist der stärkste Weckreiz überhaupt“, so Prof. Ruth.
Welchen Einfluss hat der Vollmond?
Wer mit Problemen beim Einschlafen zu kämpfen hat, solle vor dem Griff zu Medikamenten einige einfache Regeln befolgen, rät Petra Renz, Diplom-Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin am Tübinger Universitätsklinikum: Mindestens drei Stunden sportliche Bewegung pro Woche, nur zu Bett gehen, wenn man auch wirklich müde ist, auf einen Mittagsschlaf von mehr als 20 bis 30 Minuten verzichten, ebenso auf langes Lesen im Bett und auf Fernseher, Laptop und Handy im Schlafzimmer. Das blaue Licht der Displays beeinträchtigt das Einschlafen und sollte daher schon eine Stunde vorher gemieden werden.
Wenn Betroffene nachts aufwachen und nicht innerhalb von 20 Minuten wieder einschlafen können, sollten sie aufstehen und sich bewegen, bis sich die Müdigkeit erneut einstellt, lautet ein weiterer Tipp von Petra Renz. Entgegen landläufiger Meinung gebe es hingegen keine durch wissenschaftliche Studien abgesicherten Erkenntnisse darüber, dass der Vollmond einen negativen Einfluss auf das menschliche Schlafverhalten habe. Auch nicht für Wasseradern (unterirdische natürliche Wasserläufe) unter dem Haus oder elektromagnetische Felder durch strombetriebene Geräte im Haushalt.
Kinder schlafen anders
Kinder schlafen nicht nur länger als Erwachsene, ihr Schlaf enthält auch mehr Tief- und REM-Phasen – wichtig für Wachstum und Entwicklung. Sonnenlicht und Bewegung am Tag sowie feste Abendrituale wie Vorlesen oder ein Schlaflied fördern gesunden Schlaf. Koffein, Zucker und Bildschirmzeit sollten abends vermieden werden. Bei häufigen Schlafproblemen kann ärztlicher Rat sinnvoll sein.
Im interdisziplinären Kinderschlaflabor der Uni-Kinderklinik Tübingen können Schlafprobleme abgeklärt werden.
Möglichst regelmäßige Abläufe wirken dagegen positiv aufs Schlafverhalten – auch bei Menschen, die zum Beispiel wegen Schichtarbeit nicht immer zur selben Zeit ins Bett gehen können. Ihnen rät Petra Renz, den Arbeitsplatz so gut wie möglich auszuleuchten, dafür aber das heimische Schlafzimmer abzudunkeln und gegen Störungen von außen abzuschotten. Eine regelmäßige Ernährung, auch mit leichten warmen Mahlzeiten während der Nachtschichten, kann zum erholsamen Schlaf beitragen, ebenso wie Entspannungstechniken, etwa Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation, Yoga, Tai-Chi oder Chi-Gong.
Wer das alles probiert hat, aber trotzdem mindestens dreimal pro Woche über einen Zeitraum von mehr als einem Monat hinweg Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen hat, sollte die Ursache medizinisch abklären lassen: Stress, Schnarchen, Atemaussetzer während des Schlafs, aber auch beginnende Depressionen oder organische Erkrankungen können Auslöser von Schlafstörungen sein und müssen unterschiedlich therapiert werden. Unter Umständen kann der Besuch in einem Schlaflabor sinnvoll sein, wo unter ärztlicher Aufsicht Daten erhoben werden, die Rückschlüsse auf Ursache und mögliche Ansatzpunkte geben. Dafür kann das Führen eines Schlaf-Tagebuchs wichtige Hinweise liefern.
Medikamente bei Schlaflosigkeit
Sind die Ursachen abgeklärt, können unter Umständen auch Medikamente eine Hilfe darstellen. Eine Schlüsselfunktion hat dabei das Hormon Melatonin, das in der Zirbeldrüse im menschlichen Gehirn produziert wird und den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers steuert. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt die Menge des produzierten Hormons ab, weshalb synthetisch hergestelltes Melatonin als verschreibungspflichtiges Medikament für Menschen ab 55 Jahren eingesetzt werden kann. Melatonin ist außerdem für Kinder mit Autismus und Schlafstörungen zugelassen.
Ein grundlegendes Problem anderer Medikamente gegen Schlafstörungen ist jedoch, dass die meisten nur für einen eng begrenzten Zeitraum eingenommen werden dürfen – wegen der Nebenwirkungen. „Das gilt auch für eine Gruppe besonders wirksamer Medikamente, die sogenannten Benzodiazepine sowie die analog wirkenden Z-Substanzen wie Zolpidem. Sie besitzen ein hohes Suchtpotenzial und sollten daher nur zur akuten Behandlung, nicht aber auf Dauer eingesetzt werden“, betont Ruth. Andere Medikamente blockieren die körpereigenen Rezeptoren für das Hormon Histamin, das auch als „Wachheitshormon“ bezeichnet wird. Sie haben aber ebenfalls teils starke Nebenwirkungen.
Etliche Medikamente verlieren bei dauerhafter Einnahme ihre schlaffördernde Wirkung oder können sogar das Gegenteil bewirken. Dies gilt auch für die teilweise rezeptfrei erhältlichen Schlafmittel mit Doxylamin oder Diphenhydramin als Wirkstoff. Deren schlafanstoßende Wirkung ist gut bekannt. Allerdings gewöhnt sich der Körper an die Substanzen, sodass sie nach einiger Zeit nicht mehr wirken oder die Dosis laufend gesteigert werden müsste – was die Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen erhöht. Für pflanzliche Schlafmittel gibt es hingegen bisher keinerlei Wirksamkeitsnachweis, berichtet Prof. Ruth. Allerdings gab es in der Vergangenheit Fälle, in denen sich bei pflanzlichen Wirkstoffen im Nachhinein erhebliche gesundheitsschädigende Wirkungen herausgestellt haben. So wurde bei Kava Kava, einem Extrakt aus einer Pfefferpflanze, das Risiko starker Leberschädigungen festgestellt.
Eine ärztliche Begleitung ist bei der medikamentösen Behandlung unerlässlich. Dies gilt auch bei der Absetzung von Medikamenten, die in der Regel in einem langsamen Prozess des Ausschleichens, also einer allmählichen Reduktion der Dosis erfolgen sollte.