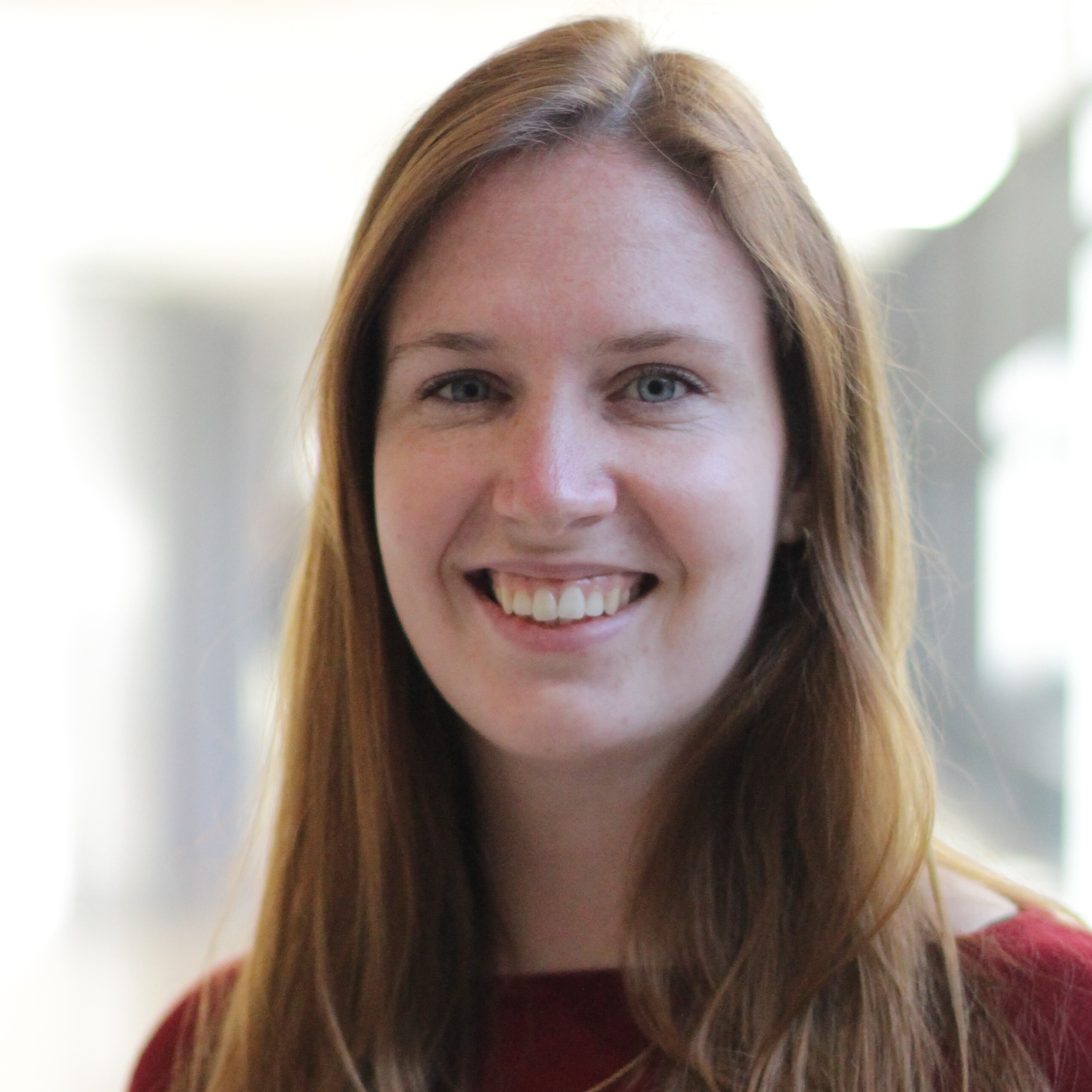Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit emotional-affektivem Verhalten und Gehirnfunktionen unter besonderer Berücksichtigung von Geschlecht, psychischer Gesundheit und Hormonhaushalt.
Geschlecht und Geschlechtshormone beeinflussen nicht nur unsere Gesundheit und unser Verhalten, sondern auch unser Gehirn. Daher widmet sich unsere Arbeitsgruppe der Untersuchung dieser Effekte auf mehreren Ebenen (Verhalten, Gehirn, Psychophysiologie und Hormonspiegel) und hinsichtlich unterschiedlicher Kompetenzen (von emotionalen Fähigkeiten und Empathie über Stress bis hin zu Motivation). Hierbei ist für uns nicht nur die Gehirnstruktur, sondern auch die Gehirnaktivität und Gehirnkonnektivität von besonderem Interesse.
Viele Patient:innen mit psychischen Erkrankungen zeigen Unterschiede und Beeinträchtigungen in diesen Bereichen und die Interaktion von Geschlecht, Hormonspiegeln und Gehirnfunktion wird von uns im Hinblick auf die Symptomatik untersucht. Darüber hinaus verfolgen wir therapeutische Interventionsansätze sowohl auf Verhaltens- als auch auf neuronaler Ebene.
In unserer interdisziplinären Arbeitsgruppe arbeiten Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Psychotherapie, Medizin, Philosophie, Psychosexologie und anderen wissenschaftlichen Bereichen.
Ein besonderes Interesse gilt der psychischen Gesundheit von Frauen während der Lebensspanne einschließlich der Auswirkungen des Menstruationszyklus, der Empfängnisverhütung, der Schwangerschaft und den Wechseljahren. Dazu konnten wir 2023 – gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Uppsala, Schweden – auch ein DFG-gefördertes Internationales Graduiertenkolleg einwerben (weitere Informationen finden Sie unter International Research Training Group IRTG2804)