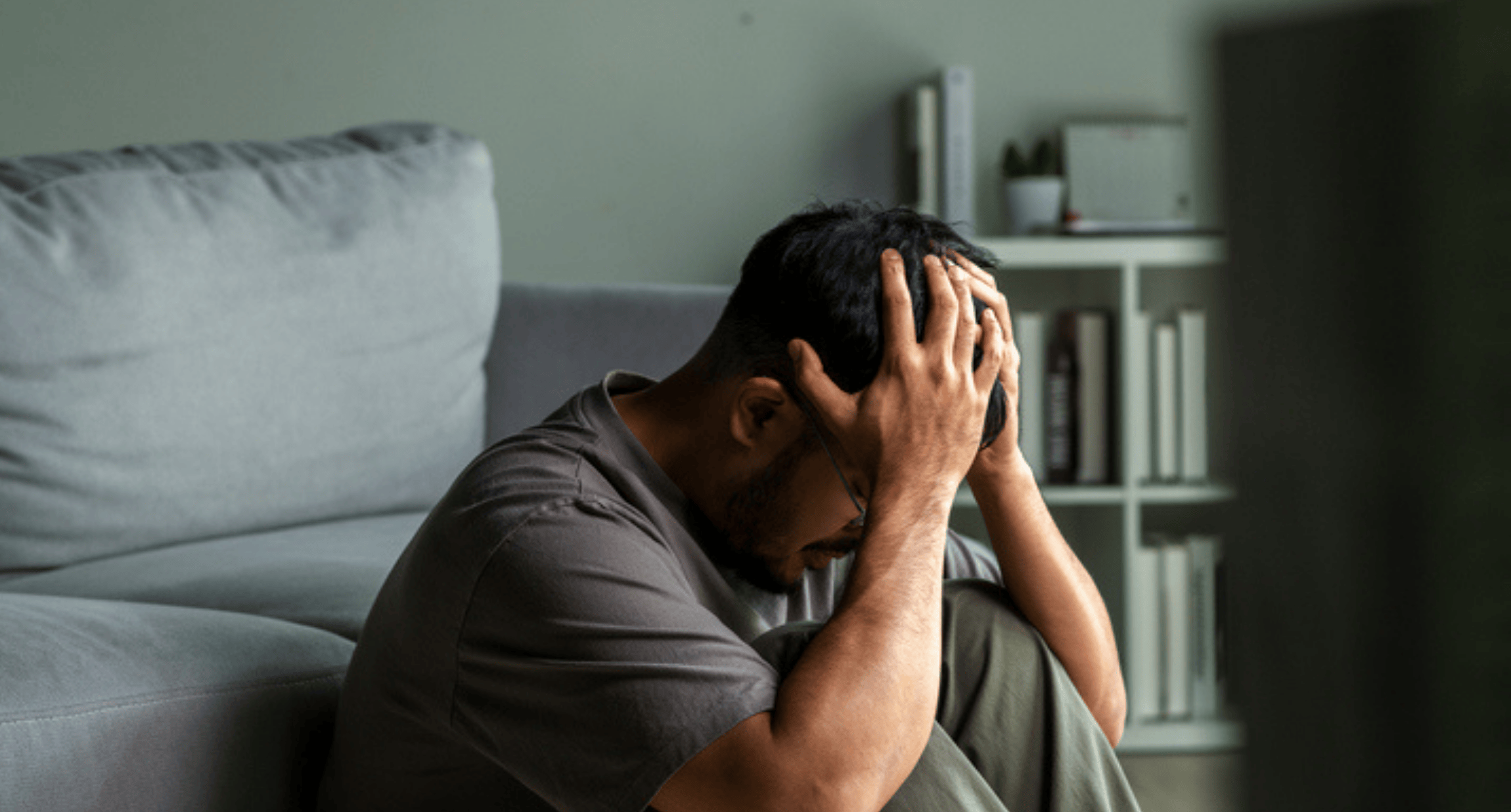Jeden Tag markiert sich Tim Grainer in seinem Fernsehmagazin den Film oder die Dokumentation, die er anschaut. Wegschmeißen kann er die Magazine nicht, ebenso wenig wie halb volle Flaschen, die er täglich von der Arbeit mit nach Hause bringt und in sorgsamer Reihenfolge auf dem Boden aufreiht. Jeden Brief, jeden Werbeprospekt öffnet er chronologisch nach Eingangsdatum. Dinge sammeln und in einer unveränderbaren Reihenfolge abarbeiten – eine Gewohnheit, die bei Grainer zum Zwang wurde. Und die ihn seit mehr als 25 Jahren begleitet. Folgt er dem Zwang nicht, hat er Angst und zittert. Er fühlt sich unvollständig und angespannt.
Etwa eine Million Menschen leben in Deutschland mit einer Zwangsstörung, die mit Depressionen und Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen zählt. Meistens werden Zwangsstörungen durch bestimmte Situationen ausgelöst: Der Auszug von zu Hause, eine Trennung von der Partnerin oder dem Partner, Verunsicherungen oder Stress. Auch bei Tim Grainer war es so. Als der von ihm empfundene Druck am Arbeitsplatz stieg, wurden seine Zwänge immer stärker. Heute bezieht der gelernte Diplom-Verwaltungswirt Erwerbsminderungsrente. Mehrmals schon stand er vor der Zwangsvollstreckung, weil er Stapel von Werbemagazinen vor wichtigen Rechnungen geöffnet hatte.
Langes Warten auf eine Diagnose
Der stationäre Aufenthalt in der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie soll Grainer von seinen Zwängen befreien. Es ist der vierte Therapieversuch für den Mitte 40-Jährigen, der seinen richtigen Namen nicht nennen möchte. Behandelt wird er von Prof. Dr. Andreas Wittorf. Der Psychologische Psychotherapeut leitet die Ambulanz für Zwangsstörungen, die sich wie nur wenige in Deutschland auf schwere Zwangsstörungen spezialisiert hat.
Immer mehr Menschen stellen sich in seiner Sprechstunde vor, was auch daran liegt, dass die Diagnose Zwangsstörung mittlerweile mehr Menschen bekannt ist. Erst 1995 hat sich die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen gegründet. Sie will Betroffene und Angehörige unterstützen – und die Öffentlichkeit aufklären.
Medikamente unterstützen die Therapie
Dass seine Zwänge sinnlos sind, weiß Grainer. „Sie sind mir auch unangenehm“, erzählt er im Sprechstundenzimmer von Wittorf. Von den Zwängen lösen kann er sich dennoch nicht. Während der Therapie erarbeitet Wittorf mit den Patientinnen und Patienten ein Verständnis für ihre Krankheit. Seit wann erleben Betroffene die Zwänge? Wann verschlimmern sie sich? Und was müsste sich ändern, damit man sich ihnen entgegenstellen kann? Auch Medikamente wie Antidepressiva unterstützen die Therapie. „Betroffenen fällt es dann oft leichter, ihre Zwänge zu kontrollieren und sich von ihnen zu distanzieren“, erklärt Wittorf.
Spezialambulanz für Zwangsstörungen
In der Spezialsprechstunde wird abgeklärt, ob eine Zwangsstörung vorliegt und ob eine psychotherapeutische oder medikamentöse Behandlung in Frage kommt. Insbesondere soll geklärt werden, ob eine stationäre Behandlung für Sie sinnvoll sein könnte. In einem etwa 50-minütigen Gespräch werden Betroffene gebeten, ihre Probleme zu beschreiben. Alle verfügbaren Vorbefunde sollten zum Gesprächstermin mitgebracht werden.
Weitere Informationen zur Terminvereinbarung gibt es hier.
Die Gruppentherapie ist ein fester Bestandteil des zwölfwöchigen stationären Aufenthaltes. Der Psychotherapeut Wittorf sitzt dann mit Patientinnen und Patienten zusammen, die unter ganz unterschiedlichen Zwängen leiden. Manche haben einen Waschzwang, stundenlang reinigen sie sich Hände und Arme, bis die Haut rissig und gerötet ist. Andere können das Haus nicht verlassen aus Angst, den Herd angelassen haben zu können. Manche können kein Messer in die Hand nehmen ohne Sorge, sich oder andere zu verletzen. Dazu kommen teilweise andere psychische Störungen wie Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen.
Vollständige Heilung ist selten
Auch die direkte Konfrontation mit dem Zwang ist ein wichtiger Teil der Therapie. Kürzlich ist Wittorf mit Tim Grainer in sein 14 Quadratmeter großes Zimmer im Wohnheim gefahren. Das Ziel: 140 PET-Flaschen endlich entsorgen. Grainer schnaufte und zögerte, dann versetzte er selbstbewusst der Flaschensammlung einen kräftigen Fußtritt. Zwei Stunden später brachten Wittorf und sein Patient sechs Säcke zum Pfandautomaten.
Die Therapie hilft den Betroffenen, das zumindest zeigt die Evaluation des stationären Programms. Nach dem Aufenthalt auf der Spezialstation haben sich die Symptome der Patientinnen und Patienten um 33 Prozent reduziert. Dass Zwangsstörungen komplett geheilt werden können, sei selten der Fall, weiß Wittorf: „Aber nach der Therapie spielen die Zwänge eine wesentlich geringere Rolle im Leben.“ Tim Grainer jedenfalls hat ein Ziel: Nach dem stationären Aufenthalt will er sich so fühlen, wie er sich beim Schach oder mit Freunden aus der Kirchengemeinde fühlt: fokussiert auf Dinge, die ihm Spaß machen, ohne dass der Zwang in sein Ohr flüstert.