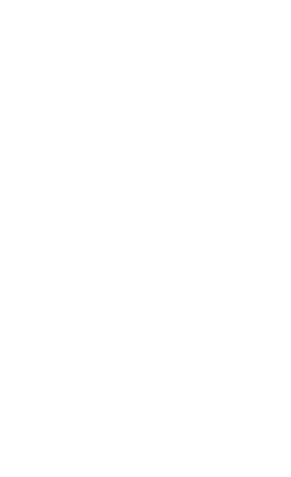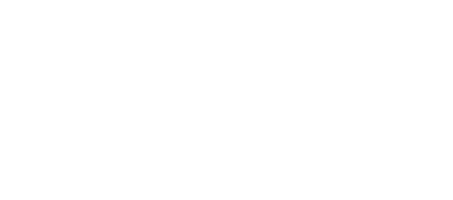Viele Raumforderungen im Bereich der Hypophyse sind seltene Prozesse. Deshalb können viele Fragestellungen nur durch Zusammenarbeit mehrerer Zentren beantwortet werden. Nur auf diese Weise kann ein hohes Niveau für die Beratung, Diagnostik und Therapie der Patienten erreicht werden. Um die Erfahrungen vieler Zentren zusammenzuführen, haben wir uns neben der Teilnahme an nationalen Registern auch an weiteren bundesweiten Umfragen und Erhebungen beteiligt oder solche initiiert [1, 2, 3]. Eine nationale Befragung beschäftigte sich beispielsweise mit den Verhaltensregeln für Patienten nach transnasaler Hypophysenoperation, um das Risiko postoperativer Komplikationen zu reduzieren [2].
Mit einer anderen Deutschland-weiten Studie konnte der Erfolg einer Temozolomid-Chemotherapie bei den seltenen aggressiv wachsenden Hypophysentumoren erforscht werden [3].
Unsere besondere Aufmerksamkeit haben auch die Patientinnen, bei denen es während der Schwangerschaft aufgrund eines Hypophysenprozesses zu einer Störung der Hypophysenfunktion oder zu akuten Sehstörungen kommt. Häufigste Diagnosen sind die Schwangerschaft-assoziierte Hypophysitis sowie das Sheehan-Syndrom (Hypophysenapoplex aufgrund einer Unterversorgung der Hypophyse bei starkem Blutverlust während der Geburt) [4]. Auch Adenome können während der Schwangerschaft an Größe zunehmen und/oder einbluten und einen Sehverlust herbeiführen. Dann muss die operative Indikationsstellung kritisch in Zusammenschau des aktuellen Zustandes der Patientin sowie des Kindes geprüft werden.
Um ein erfolgreiches operatives Outcome zu gewährleisten, werden die durchgeführten Eingriffe stets analysiert und evaluiert. Die Erfahrung des Operateurs ist dabei einer der wichtigsten Aspekte für ein erfolgreiches Ergebnis [5, 6, 7, 8].
Ausgewählte Literatur:
[1] Petersenn S, Honegger J, Quinkler M: National German audit of diagnosis, treatment, and teaching in secondary adrenal insufficiency. Horm Metab Res 2017; 49:580-588
[2] Knappe UJ, Moskopp D, Gerlach R, Conrad J, Flitsch J, Honegger JB: Consensus on postoperative recommendations after transsphenoidal surgery. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2019;127(1):29-36
[3] Elbelt U, Schlaffer SM, Buchfelder M, et al.: Efficacy of temozolomide therapy in patients with aggressive pituitary adenomas and carcinomas – a Germany survey. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(3):660-675
[4] Honegger J, Giese S: Acute pituitary disease in pregnancy: how to handle hypophysitis and Sheehan’s syndrome. Minerva Endocrinol. 2018; 43(4):465-475
[5] Honegger J, Grimm F: The experience with transsphenoidal surgery and its importance to outcomes. Pituitary. 2018;21(5):545-555
[6] Wilhelm H, Honegger JB, Paulsen F: Neuro-ophthalmological considerations on meningiomas of the anterior visual pathways. Klin Monbl Augenheilkd. 2019;236(11):1312-1317
[7] Adib SD, Herlan S, Ebner FH, et al.: Interoptic, trans-lamina terminalis, opticocarotid triangle, and caroticosylvian windows from mini-supraorbital, frontomedial and pterional perspectives: a comparative cadaver study with artificial lesions. Front Surg. 2019 Jul; 6:40
[8] Adib SD, Platz J, Schittenhelm J, et al.: Transsphenoidal removal of recurrent osteoid osteoma of clivus. World Neurosurg. 2018; 120:506-508