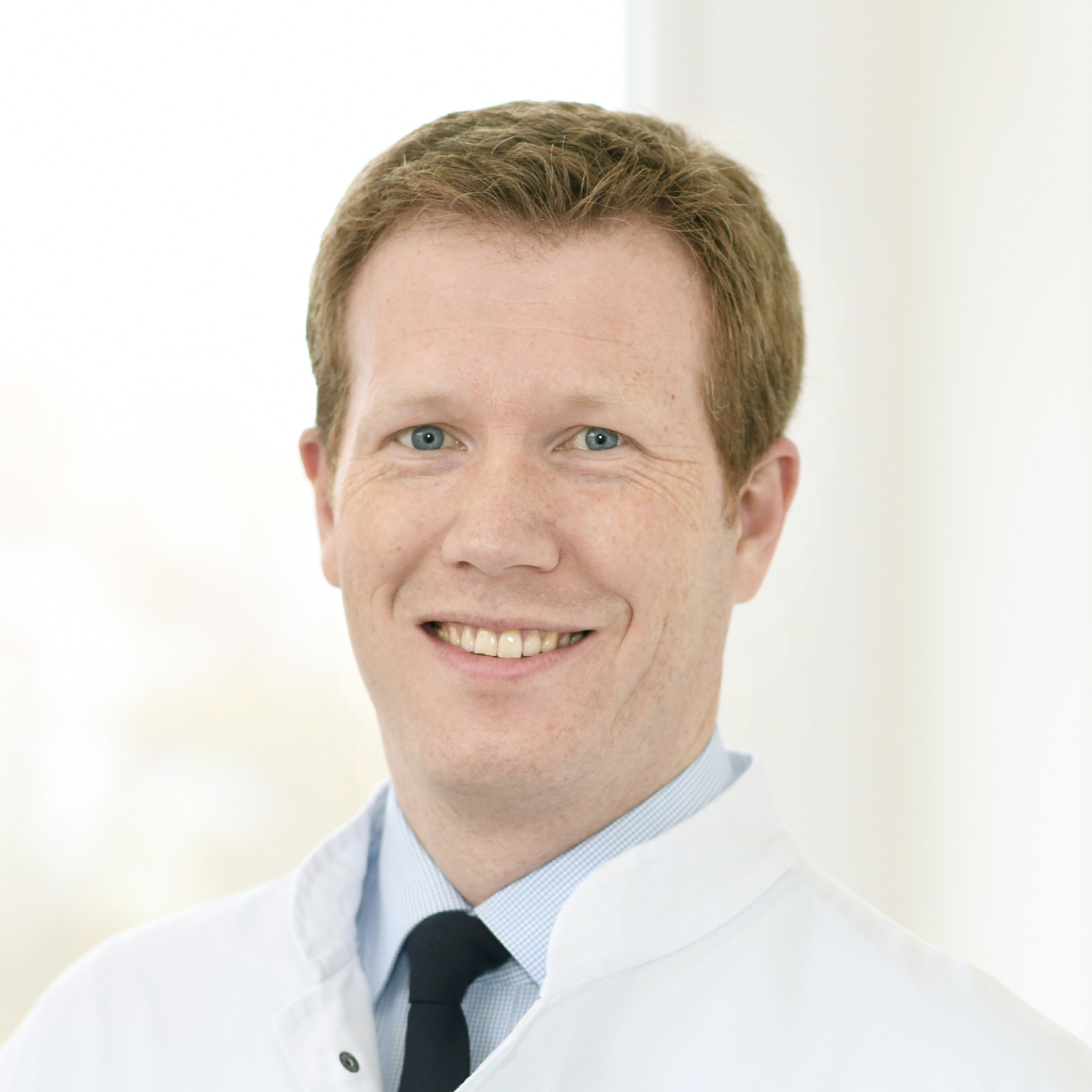Eierstockkrebs ist insgesamt eine seltene Erkrankung im Bereich der gynäkologischen Onkologie. Jährlich erkranken in Deutschland circa 8.000 Frauen. Im Vergleich hierzu erkranken circa 70.000 Frauen an Brustkrebs. Der klassische Begriff Eierstockkrebs beinhaltet auch Eileiter- und Bauchfellkrebs. Oftmals entsteht der Eierstockkrebs aus den Eileitern bzw. findet man hier bereits Krebs-Vorstufen. Im Vergleich zu Brustkrebs gibt es keine etablierten Vorsorgeuntersuchungen und meist fehlen Frühsymptome, weswegen die Erkrankung häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt wird.
Eierstockkrebs
Der stille Feind

Doch auch hier bietet die Medizin heute Möglichkeiten, den Krebs zurückzudrängen, zu heilen oder zumindest die Lebenszeit zu verlängern. Wird der Krebs frühzeitig erkannt und vollständig entfernt, sind die Heilungschancen gut.
Wir sprachen mit Dr. Jürgen Andress, Leitender Oberarzt des Departments für Frauenheilkunde und Leiter des Zentrums für Gynäkologische Onkologie der Universitätsfrauenklinik und weiteren Experten und Expertinnen über die Behandlungsmöglichkeiten.
Ablauf Eierstockkrebs-Behandlung

1. Sprechstunde
Patientinnen, bei denen ein Verdacht auf Eierstockkrebs besteht, werden in der Sprechstunde des zertifizierten Zentrums für Gynäkologie umfassend untersucht. Der Fall wird in der Tumorkonferenz nach entsprechenden Staging-Untersuchungen besprochen und das weitere Vorgehen festgelegt.

2. Stationäre Aufnahme
Zu einer geplanten Operation wird die Patientin stationär aufgenommen und operiert. Hierbei wird versucht, den Tumor komplett zu entfernen.

3. Behandlung
Neben der maximalen operativen Tumorentfernung gehört auch fast immer eine anschließende Chemotherapie zum Standard der Eierstockkrebs-Behandlung. Eine Ausnahme bilden die absoluten Frühstadien ohne Risikofaktoren.

4. Nachsorge
Alle Frauen mit Eierstockkrebs sollten nach Abschluss der Therapie eine Nachsorge erhalten. Diese sollte in enger Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärztinnen, Ärzten und Kliniken erfolgen.
Eierstockkrebs – der stille Feind
Wer ist betroffen?
Eierstockkrebs ist eine seltene Tumorerkrankung. Das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, steigt jedoch mit zunehmendem Alter. Betroffen sind vor allem Frauen zwischen dem 60. und 85. Lebensjahr. Gerade nach den Wechseljahren ist es daher wichtig, auffällige Befunde an den Eierstöcken abklären zu lassen.
Auch wenn der klassische Eierstockkrebs bei Frauen unter 50 Jahren seltener auftritt, gibt es dennoch Unterarten dieser Erkrankung, die auch Frauen vor den Wechseljahren betreffen können. So kann Eierstockkrebs beispielsweise erblich bedingt sein und in einer Familie gehäuft auftreten.
Aber nicht jede Veränderung an den Eierstöcken ist gleich Krebs. Häufig handelt es sich auch um Zysten oder andere gutartige Veränderungen.
Warum wird der Krebs oft erst spät entdeckt?
Die beiden Eierstöcke, auch Ovarien genannt, gehören wie die Gebärmutter, die Eileiter und die Scheide zu den inneren weiblichen Geschlechtsorganen. Sie liegen im Becken zwischen Harnblase und Enddarm zu beiden Seiten der Gebärmutter und enthalten die Eizellen, die sie an die Eileiter abgeben. Aufgrund ihrer Lage im Bauchraum haben Eierstocktumore viel Platz, um unbemerkt zu wachsen, ohne dass die Patientin Beschwerden hat. Verdachtsmomente können eine Zunahme des Bauchumfangs, unklare Unterbauchschmerzen aber auch ungewohnte Verdauungsbeschwerden in Verbindung mit einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes sein.
Was ist Eierstockkrebs?
Die meisten Eierstocktumore wachsen zunächst im kleinen Becken, sie können sich aber auch über den erkrankten Eierstock und die Eileiter ausbreiten und in die Gebärmutter oder den Darm eindringen. In fortgeschrittenen Stadien kann sich der Eierstockkrebs im gesamten Bauchraum ausbreiten und Metastasen im Bauchfell bilden (Peritonealkarzinose). Dadurch sammelt sich häufig viel Flüssigkeit im Bauchraum an, was die Symptome der Patientin deutlich verstärken kann. Außerdem breitet sich Eierstockkrebs über die Lymphbahnen aus und bildet Metastasen in den Lymphknoten. Eher selten kommt es zu Metastasen in der Lunge, Leber oder den Knochen.
Wie wird vorgegangen?
Patientinnen mit Verdacht auf Eierstockkrebs werden zunächst in der Sprechstunde des zertifizierten Zentrums für Gynäkoonkologie umfassend untersucht. Das Tumorboard, eine Gruppe von Spezialisten und Spezialistinnen aller Fachrichtungen, gibt dann auf Basis der Untersuchungsergebnisse eine Behandlungsempfehlung ab. Danach erfolgt ein erneutes Beratungsgespräch in unserer Sprechstunde, um das weitere Vorgehen bzw. die Operation zu planen.
Was passiert bei der Operation?
Bei der Operation werden der gesamte Bauchraum und alle darin liegenden Organe sorgfältig untersucht. Dr. Jürgen Andress: „Dazu öffnen wir den Bauch mit einem Längsschnitt vom Schambein bis zum unteren Rand des Brustbeins. Ziel ist es, den Tumor komplett mit allen seinen Absiedlungen zu entnehmen.“ Je nach Ausdehnung des Tumors müssen neben den Eierstöcken und Eileitern die Gebärmutter, das Netz, das den Bauchraum auskleidet, sowie Teile des Bauchfells, des Darms, der Blase und befallene Lymphknoten entfernt werden. Bereits während der Operation wird das entnommene Gewebe von der Pathologie auf Tumorzellen untersucht, um die Diagnose zu sichern. Die Operation erfolgt in der Regel gemeinsam mit einem erfahrenen Team der Kolleginnen und Kollegen der Chirurgie.
Rund 100 dieser sechs- bis zehnstündigen Operationen werden am Uniklinikum jedes Jahr durchgeführt. „Das A und O für den Behandlungserfolg ist eine Operation, die wirklich alle Teile des Tumors entfernt“ erläutert Dr. Jürgen Andress. In der Uniklinik stehen dabei neben den Spezialistinnen und Spezialisten für gynäkologische Operationen auch erfahrene Chirurgen und Chirurginnen aus der Bauchchirurgie und der Urologie zur Verfügung, falls Teile des Darms oder der Blase entfernt werden müssen. „Diese geballte Expertise kann nur ein großes Zentrum wie zum Beispiel eine Universitätsklinik bieten“, betont Prof. Sara Brucker, die zusammen mit Dr. Jürgen Andress ein Chirurgenteam bildet, das über sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet der Eierstockchirurgie verfügt.
Die meisten Eierstocktumore entwickeln sich zunächst im kleinen Becken und haben durch ihre Lage im Bauchraum viel Platz, um unbemerkt zu wachsen.
Unsere Erfahrung zeigt
Die Operation von Eierstocktumoren erfordert eine hohe Expertise, routinierte Behandlungsabläufe und die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen. Am Uniklinikum Tübingen stehen dafür neben den Spezialisten für gynäkologische Operationen auch erfahrene Operateure aus der Bauchchirurgie, Gefäßchirurgie und Urologie zur Verfügung.
Pro Jahr werden in der Universitäts-Frauenklinik weit über 100 Patientinnen mit bösartigen Eierstockerkrankungen behandelt. Das Zentrum entwickelt gemeinsam mit den Betroffenen individuelle Behandlungskonzepte. Dabei sind die persönlichen Wünsche und Interessen der Patientinnen (z. B. Kinderwunsch) von großer Bedeutung. Therapiemaßnahmen werden, wenn möglich, entsprechend abgestimmt.
Zur bestmöglichen Behandlung um die operative Versorgung herum, zählt heutzutage auch das so genannte ERAS Konzept. Es handelt sich dabei um ein multimodales Konzept, das verschiedene Maßnahmen umfasst, die vor, während und nach der Operation aufeinander abgestimmt sind. Im Rahmen dieses Konzeptes arbeiten Chirurgen, Anästhesisten bis hin zu Physiotherapeuten und Pflegepersonal eng zusammen, um die Genesung der Patientinnen optimal zu unterstützen.
Die Universitäts-Frauenklinik Tübingen ist Studienleitzentrum der AGO Studiengruppe. Die Patientinnen haben somit Zugang zu den neuesten Therapieverfahren und bekommen die Möglichkeit sich im Rahmen von klinischen Studien auf Grundlage des aktuellen Forschungsstandes behandeln zu lassen.

„Diese geballte Expertise kann nur ein großes Zentrum wie zum Beispiel eine Universitätsklinik bieten.“
Prof. Dr. Diethelm Wallwiener
Ziele des ERAS-Konzepts
- Durch eine sorgfältige Vorbereitung und Begleitung wird versucht, die Stressbelastung für Ihren Körper zu minimieren.
- Ihr Körper soll in die Lage versetzt werden, sich selbst zu regulieren und so die Heilung zu fördern.
- Durch das ERAS-Konzept sollen Risiken wie Herzrhythmusstörungen, Lungenentzündungen oder andere postoperative Komplikationen verringert werden.
- Studien zeigen, dass Patientinnen, die nach dem ERAS-Konzept behandelt wurden, oft kürzere Aufenthalte im Krankenhaus haben, ohne dass es zu einer erhöhten Rate an Wiederaufnahmen kommt.
Vorbereitung auf die Operation
- Eine ausgewogene Ernährung vor der Operation kann Ihre Genesung positiv beeinflussen.
- Bleiben Sie aktiv. Sport und Bewegung können die Heilung erwiesenermaßen fördern.
Nach der Operation
- Versuchen Sie, so früh wie möglich wieder in Bewegung zu kommen, natürlich unter Anleitung und soweit es Ihnen möglich ist, wir unterstützen Sie hierbei!
- Auch nach der Operation ist eine ausgewogene Ernährung wichtig für Ihre Genesung.
- Zögern Sie nicht, Unterstützung von Familie, Freunden, Pflegepersonal oder Psychoonkologen anzunehmen.
Die Chemotherapie – der zweite Therapiepfeiler
Auch wenn der Tumor vollständig operiert ist, verbleiben bei Eierstockkrebs oftmals bösartige Zellen, die zwar nicht sichtbar sind, aber Ausgangspunkt für einen Rückfall, ein sogenanntes Rezidiv, sein können.
Dr. Tobias Engler, Stv. Geschäftsführender Oberarzt: „Am Zentrum für Gynäkologische Onkologie ist im Anschluss an die Operation fast immer eine Chemotherapie notwendig. Da Eierstockkrebs in der Regel gut auf eine Chemotherapie anspricht, verringert diese das Rückfallrisiko erheblich.“ In manchen Fällen ist der Eierstockkrebs bereits bei der Diagnose so weit fortgeschritten, dass eine primäre Operation zunächst nicht möglich ist und daher als erstes mit der Chemotherapie begonnen wird. Eine operative Versorgung erfolgt dann üblicherweise nach drei oder sechs Zyklen Chemotherapie, je nach Ansprechen des Tumors, welches bildgebend kontrolliert wird.
Außerdem wurden - zusätzlich zur klassischen Chemotherapie - in den letzten Jahren eine Reihe von sehr effektiven tumorspezifischen Medikamenten entwickelt, die eine maßgeschneiderte, d.h. individualisierte Tumortherapie, ermöglichen. Mit speziellen Antikörpern (sogenannten Angiogenese-Inhibitoren) kann zum Beispiel die Gefäßneubildung in Tumoren verhindert werden. Die Krebszellen werden dann nicht mehr mit Blut versorgt und „verhungern“.
Andere Medikamente (sogenannte PARP-Inhibitoren) verhindern, dass Krebszellen ihr Erbgut reparieren können, wodurch Fehler im Erbgut der Tumorzellen entstehen und diese nicht mehr überleben können. PARP-Inhibitoren sind unter anderem bei Frauen mit erblichem Eierstockkrebs hoch wirksam. Auch die Immuntherapie, bei der die Stärke der körpereigenen Abwehr zur Bekämpfung von Krebs genutzt wird, kommt mittlerweile im Rahmen von klinischen Studien bei Eierstockkrebs zum Einsatz.
Ein weiterer sehr vielversprechender Therapieansatz sind die sogenannten Antikörper-Wirkstoffkonjugate, welche auch im Rahmen von Studien bei uns in der Frauenklinik angewandt werden. Hierbei wird ein Antikörper mit einer Chemotherapie bestückt und diese direkt zu den Tumorzellen transportiert.
Woran forschen wir?
Als Universitätsklinikum bieten wir unseren Patientinnen die Teilnahme an verschiedenen nationalen und internationalen Studien an. Studienschwerpunkte liegen hier im Bereich des operativen Vorgehens als auch in neuen zielgerichteten Therapien. Unsere Studien decken sowohl Patientinnen in einem frühen Krankheitsstadium als auch in fortgeschrittenen oder rezidivierten Situationen ab.
Familiäre Belastung
Die Universitäts-Frauenklinik in Verbund mit dem Institut für medizinische Genetik und angewandte Genomik der Universität Tübingen ist Mitglied des deutschen Konsortiums für familiären Brust- und Eierstockkrebs und seit 2023 durch die deutsche Krebsgesellschaft (DKH) als FBREK-Zentrum zertifiziert. Interessierte Ratsuchende, Patientinnen und deren Familienangehörige können somit eine interdisziplinäre Beratung wahrnehmen, die sich an den Empfehlungen der Deutschen Krebshilfe orientiert.
Kontaktieren Sie uns
Universitäts-Frauenklinik
frontend.sr-only_#{element.icon}:
Calwerstraße 7
72076 Tübingen
frontend.sr-only_#{element.icon}:
07071 29-82224
Call-Center
E-Mail-Adresse: Eierstockkrebs@med.uni-tuebingen.de
Unser interdisziplinäres Team

Prof. Dr. med. Sara Y. Brucker
Ärztliche Direktorin Department für Frauengesundheit
Publikationen: Publikationen

Prof. Dr. med. h. c. mult. Diethelm Wallwiener
Ärztlicher Senior Professor der Universitäts-Frauenklinik Tübingen
Publikationen: Publikationen

Prof. Dr. med. André L. Mihaljevic, M.Sc. M.Sc. MME MBA
Ärztlicher Direktor Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie
Publikationen: PubMed

Prof. Dr. med. Bernhard Krämer
Stellv. Ärztlicher Direktor Gynäkologie der Universitäts-Frauenklinik

Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Hartkopf, MHBA
Ärztlicher Direktor Forschungsinstitut für Frauengesundheit, Sektionsleiter Translationale & Systemische Gynäkoonkologie
Publikationen: Link zur Publikationsliste auf Pubmed

Prof. Dr. med. Eva-Maria Grischke
Ständige Klinische Vertretung der Universitäts-Frauenklinik