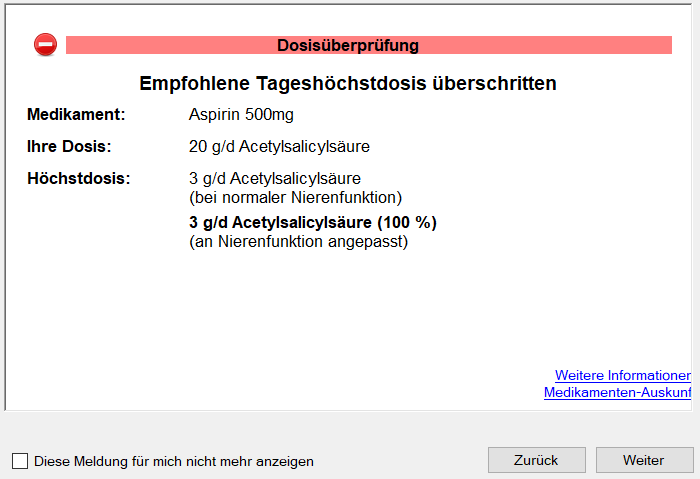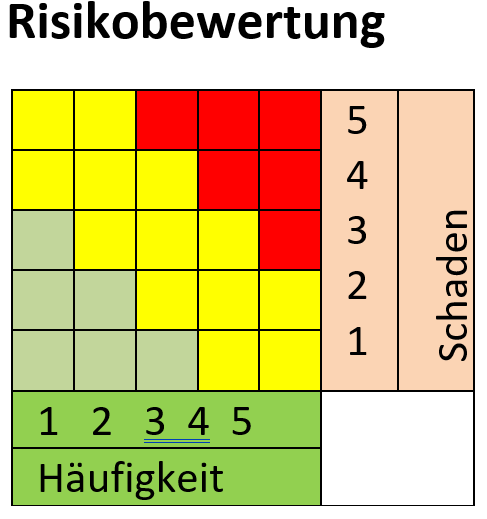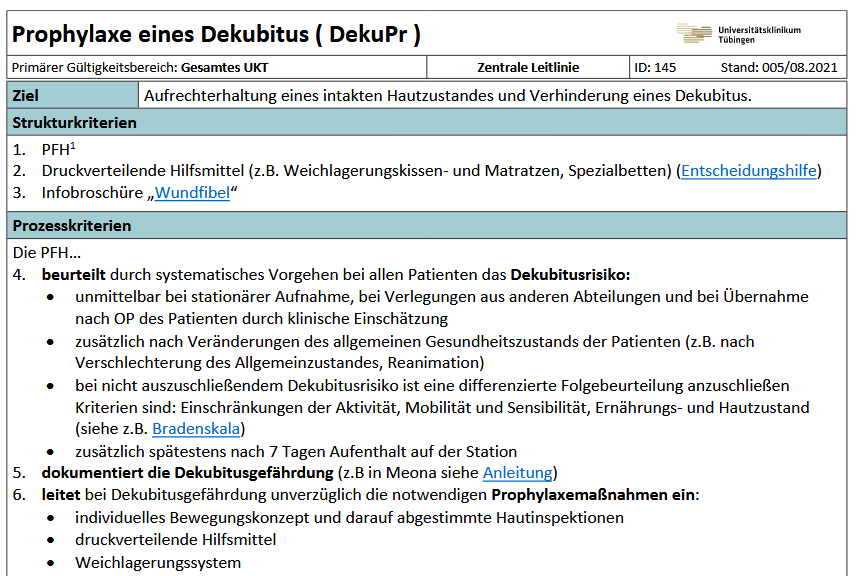Über das Patientensicherheits-Informationssystem (pasis) können Mitarbeitende unerwünschte Ereignisse und Beinahe-Schäden anonym melden. Diese werden regelmäßig in der Kommission Patientensicherheit analysiert und bewertet. Die Fachkommission setzt sich aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, sowie aus Beschäftigten der Krankenhaushygiene, der Apotheke, des Medizinisch-Technischen Servicezentrums, der Rechtsabteilung, der Arbeitssicherheit und des Personalrates zusammen. Entsprechend werden Maßnahmen abgeleitet und Projekte angestoßen, um mögliche Schäden zukünftig zu vermeiden.
Die anonymen Meldungen werden in einer nationalen Datenbank registriert, damit auch andere Krankenhäuser von den Meldungen profitieren. Zugleich hat das Universitätsklinikum Tübingen Zugriff auf Ereignisse anderer Gesundheitseinrichtungen, um aus Fehlern anderer zu lernen. Alle patientensicherheitsrelevanten Meldungen – wie beispielsweise Beschwerden – werden zusätzlich an das Risikomanagement zur Analyse und Bearbeitung weitergeleitet.