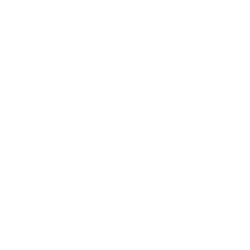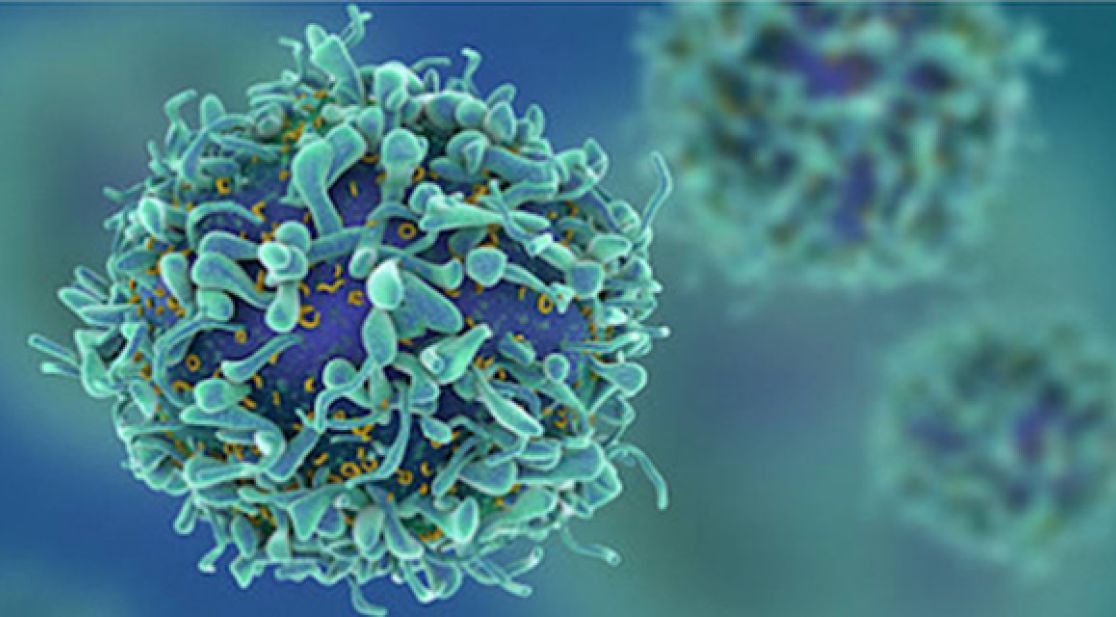Krebsforschung
Jahr für Jahr wird eine vierstellige Zahl an Patientinnen und Patienten bei uns in klinischen Therapiestudien behandelt. Außerdem gibt es am Standort Tübingen international sichtbare Aktivitäten im Bereich der präklinischen Forschung und der frühen klinischen Studien.