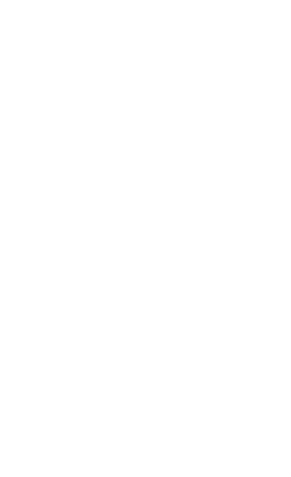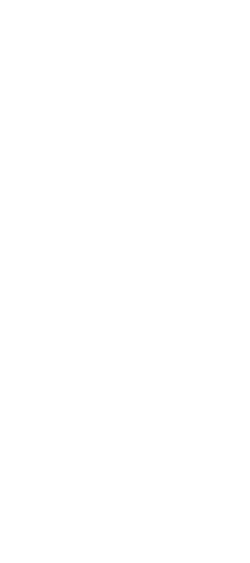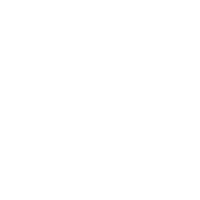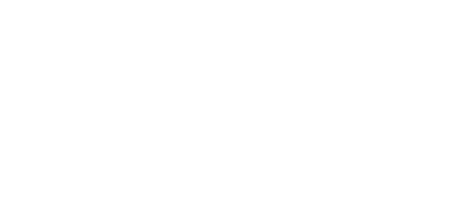Über uns
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Diagnostik und Therapie internistischer Erkrankungen mit Schwerpunkt auf Erkrankungen des Blutes (Hämatologie und Hämatologische Onkologie), Gerinnungsstörungen (Hämostaseologie), komplexe Tumorerkrankungen solider Organe (Internistische Onkologie), Immundefekte, Autoimmunkrankheiten und immunologische Störungen (Klinische Immunologie) und rheumatologische Erkrankungen (Rheumatologie). Hier bieten wir das gesamte Spektrum der Systemtherapie an, inklusive personalisierter Ansätze der molekularen und immunologischen Therapie, autologer und allogener Blutstammzelltransplantationen, CAR-T Zellen und anderer innovativer Zelltherapien.