
Sektionen und Arbeitsgruppen
Sektion für Suchtmedizin und Suchtforschung
Erforschung von Abhängigkeiten und verhaltensbezogener Süchte.
Mehr erfahrenSektion für Demenzforschung
Entwicklung innovativer diagnostischer Instrumente zur Früherkennung kognitiver Störungen.
Mehr erfahrenArbeitsgruppen
Affektive Neuropsychiatrie (Wildgruber)
In der Arbeitsgruppe Affektive Neuropsychiatrie werden neurobiologische Grundlagen emotionaler Prozesse bei gesunden Probanden und bei Patienten mit gestörter Emotionsverarbeitung untersucht (z.B. Depression, Schizophrenie, Angststörung).
Affektive Störungen (Batra)
Der Arbeitskreis PAS – Psychotherapieforschung bei affektiven Störungen untersucht die Wirksamkeit und Wirkfaktoren der Psychotherapie bei depressiven Störungen und Angststörungen. Aktuell werden dabei insbesondere die Wirksamkeit und Wirkfaktoren der Hypnotherapie untersucht.
Angewandte Neurotechnologie (Soekadar)
Die Arbeitsgruppe Angewandte Neurotechnologie ist eine Schnittstelle zwischen dem Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und dem MEG-Zentrum.
Angstforschung (Kreifelts)
Die AG Angstforschung befasst sich inhaltlich mit allen Spielarten der Angst sowohl im klinischen als auch im normalpsychologischen Bereich. Dabei werden vornehmlich mit neurowissenschaftlichen Methoden die zugrundeliegenden neurobiologischen Prozesse untersucht.
Demenz (Laske)
Schwerpunkt der Forschungsprojekte der Arbeitsgruppe Demenz sind die Untersuchung von Patienten mit leichten kognitiven Störungen und Demenzerkrankungen mit neuropsychologischen und bildgebenden Verfahren (Kooperation mit der Sektion für experimentelle Kernspinresonanz des ZNS, Abteilung Neuroradiologie der Radiologischen Klinik, Universitätsklinikum Tübingen). Es wurden Testverfahren entwickelt, evaluiert sowie ihre Grundlagen und neuronalen Korrelate untersucht. Diese Projekte werden weitergeführt und vertieft.
Kognitive Neuropsychiatrie (Rapp)
Die Arbeitsgruppe Kognitive Neuropsychiatrie beschäftigt sich mit den Neuronalen Korrelaten psychopathologischer Symptome. Mit Methoden moderner funktioneller und struktureller Bildgebung beschäftigen wir uns darüber hinaus mit den Korrelaten von Sprache, Humor, Ich-Bewusstsein und Gedächtnis bei Gesunden.
Lehrentwicklung und medizinische Ausbildungsforschung (Reichel / Pelzl)
Wir beschäftigen uns mit der Neu- und Weiterentwicklung von Lehr- und Lernmaterialien. Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse des Ausbildungsstandes und Verbesserung der psychiatrischen Lehre durch eine inhaltliche und methodische Qualitätssicherung.
Mental Health Mapping (Wolfers)
In the laboratory for Mental Health Mapping (PI: Thomas Wolfers) we aim to make a difference for people with complex health challenges. Each person’s trajectory through life is a consequence of a complex developmental process, that involves biological, social, societal, and environmental factors. In our research we use large and diverse datasets in combination with machine learning to map this process. We collaborate with patients and clinicians building bridges between clinical practice and basic research in neuroscience and machine learning, with the ultimate objective to translate our work into clinical practice.
Molekulare Psychiatrie (Nieratschker)
Die Arbeitsgruppe Molekulare Psychiatrie untersucht genetische und epigenetische Grundlagen psychiatrischer Erkrankungen. Bei psychiatrischen Erkrankungen handelt es sich um komplexe Krankheiten, zu denen verschiedene genetische, epigenetische und umweltbedingte Faktoren beitragen. Mit der Erforschung der biologischen Grundlagen dieser Erkrankungen versuchen wir, die Entstehung und den Verlauf psychischer Erkrankungen besser zu verstehen und somit zur Entwicklung einer effizienteren Therapie und Vorsorge beizutragen.
MR-Bildgebung (Ethofer)
Neurobiologie der Kognition (Lindner)
Die Arbeitsgruppe „Neurobiologie der Kognition“ (kurz „NoCo-Lab“ = „Neurobiology of Cognition“ Laboratory) untersucht die neurobiologischen Grundlagen kognitiver Leistungen und deren Veränderung durch Altern und durch psychiatrische und neurologische Erkrankungen.
Neurophysiologie & Interventionelle Neuropsychiatrie (Plewnia)
Die Arbeitsgruppe Neurophysiologie & Interventionelle Neuropsychiatrie beschäftigt sich mit Verfahren zur elektromagnetische Stimulation des menschlichen Gehirns wie transkranielle Magnetstimulation (TMS), tiefe Hirnstimulation (DBS), Elektrokrampftherapie (EKT) und transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS). Diese Verfahren gewinnen in Forschung und Klinik der Psychiatrie zunehmend an Bedeutung.
Neuroplastizität und Lernen (Karim)
Die Arbeitsgruppe Neuroplastizität und Lernen untersucht inwiefern Lernprozesse zu neuroplastischen Veränderungen im Gehirn führen und wie diese Lernprozesse bei psychiatrischen und neurologischen Störungen durch nicht-invasive Hirnstimulationsverfahren verbessert werden können.
Neurotechnology and Computational Psychiatry (Kaufmann)
In der Arbeitsgruppe Neurotechnology and Computational Psychiatry werden hochdimensionale Datensätze aus den Bereichen Bildgebung des Gehirns, Genetik und Symptomatik analysiert.
Neurowissenschaften der Motivation, des Handelns und der Begierde (Kroemer)
Psychedelika-unterstützte Psychotherapie (Batra)
Die Arbeitsgruppe Psychedelika-unterstützte Psychotherapie beschäftigt sich mit dem Einsatz von Psychedelika in der Behandlung therapieresistenter psychischer Erkrankungen, allen voran der therapieresistenten Depression.
Psychische Gesundheit & Gehirnfunktion von Frauen (Derntl)
Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit emotional-affektivem Verhalten und Gehirnfunktionen unter besonderer Berücksichtigung von Geschlecht, psychischer Gesundheit und Hormonhaushalt.
Psychogenomics (Mössner)
Die Arbeitsgruppe erforscht das Ansprechen psychischer Erkrankungen auf psychopharmakologische Medikamente und auf Psychotherapie. Ziel ist, die Besserung psychischer Erkrankungen besser zu verstehen und in Zukunft die optimalen therapeutischen Ansätze noch genauer auswählen zu können. Dies ist der Ansatz der Präzisionsmedizin.
Psychophysiologie & Optische Bildgebung (Ehlis)
Die Arbeitsgruppe Psychophysiologie & Optische Bildgebung beschäftigt sich mit der Messung der Hirnfunktion sowie peripher-physiologischer Variablen (z. B. Hautleitfähigkeit) bei psychiatrischen Patienten (z. B. Schizophrenien, affektive Erkrankungen, Angststörungen, ADHS, Demenz) und gesunden Kontrollpersonen.
Psychotherapieforschung (Klingberg)
Die Arbeitsgruppe Psychotherapieforschung beschäftigt sich mit der Wirksamkeit und Wirkungsweise von Psychotherapie bei schweren psychischen Störungen, insbesondere bei Psychosen.
Soziale Neurowissenschaften (Pavlova)
Die Arbeitsgruppe Soziale Neurowissenschaft untersucht grundlegende Verhaltensmechanismen und neuronale Korrelate sozialer Kognition (unsere Fähigkeit, die Absichten und Emotionen anderer zu verstehen).
Translationale Psychiatrie (Walter)
Neurologische Charakteristika affektiver Störungen, insbesondere der Depression.
Unsere Forschungszentren
Zentrum für Hirnstimulation (ZfH)
Behandlung von Depressionen mit transkranieller Magnetstimulation (TMS).
Kompetenzzentrum Psychotherapie
Verbesserung der psychotherapeutischen Krankenversorgung, Forschung und Lehre.
Computational Psychiatry
Untersucht den Zusammenhang von psychischer Gesundheit mit Gehirnstruktur und -funktion, sowie zugrundeliegender Genetik.
Laboratorien
Laboratorien
Psychologisches Testlabor
Im psychologischen Testlabor kommen in erster Linie neuropsychologische Untersuchungsverfahren zum Einsatz, die einen Beitrag zur psychiatrischen Diagnostik und Behandlungsplanung leisten können. Die psychologisch-diagnostische Untersuchung wird von Diplom-Psychologen geplant, befundet und beurteilt.
Neurochemische Biomarker
Die Forschungsgruppe Neurochemische Biomarker befasst sich mit der Entwicklung genauer und zuverlässiger Bioassays, welche die Bestimmung relevanter Proteine aus dem peripheren Blut gestatten. Erste Ergebnisse weisen auf die Möglichkeit hin, in den nächsten Jahren effektive Biomarker aus Serum oder Plasma für die Früh- und Differentialdiagnostik der Alzheimer-Demenz zu etablieren.
Molekulare Psychiatrie
Die Arbeitsgruppe Molekulare Psychiatrie untersucht genetische und epigenetische Grundlagen psychiatrischer Erkrankungen. Bei psychiatrischen Erkrankungen handelt es sich um komplexe Krankheiten, zu denen verschiedene genetische, epigenetische und umweltbedingte Faktoren beitragen.
Zertifikate und Verbände

Focus: Top Nationales Krankenhaus 2025

Stern: Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege 24/25
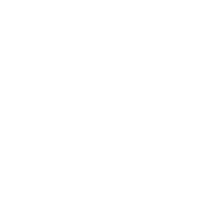
Qualitätspartnerschaft mit der PKV

Erfolgsfaktor Familie

Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst





